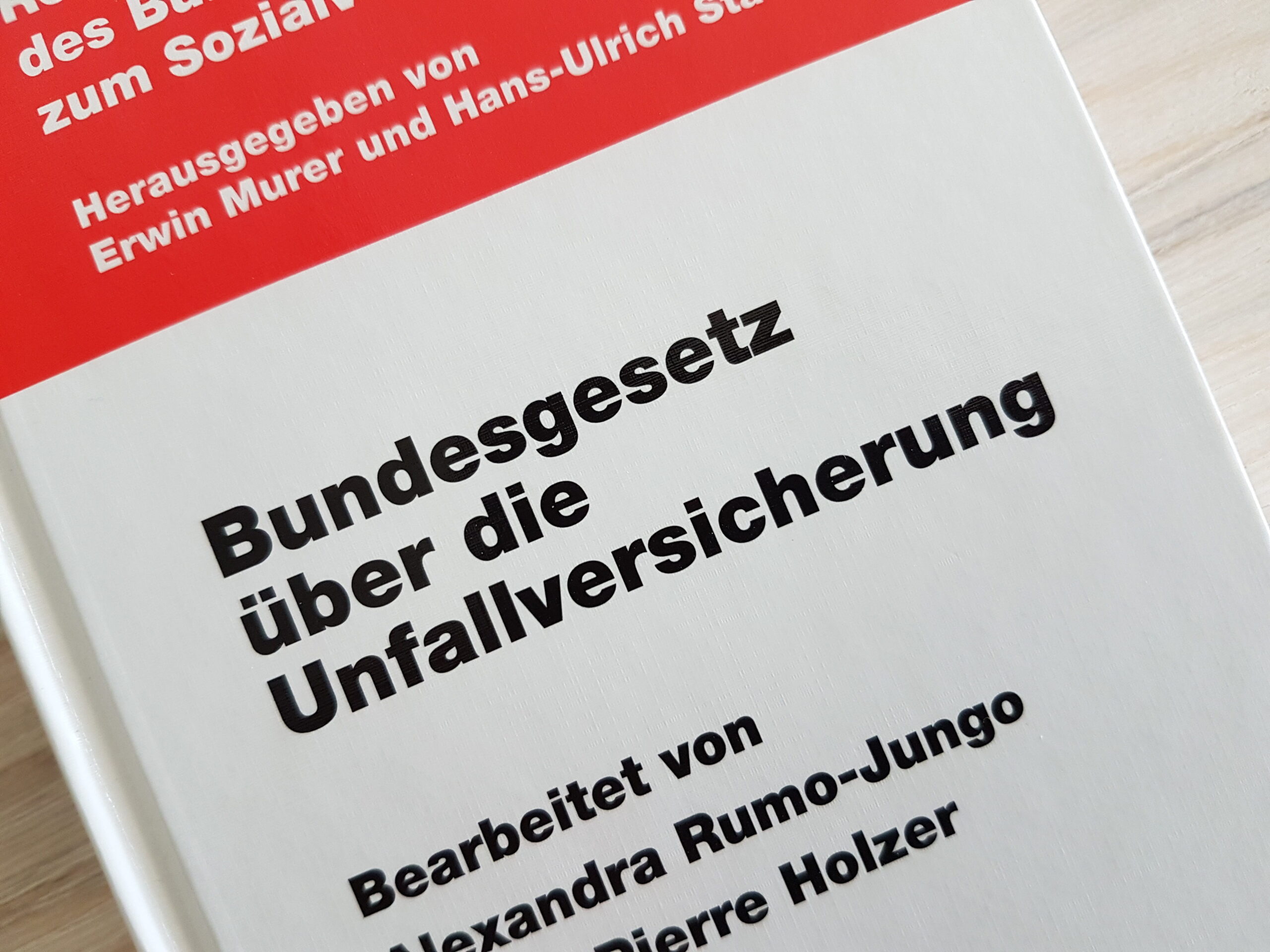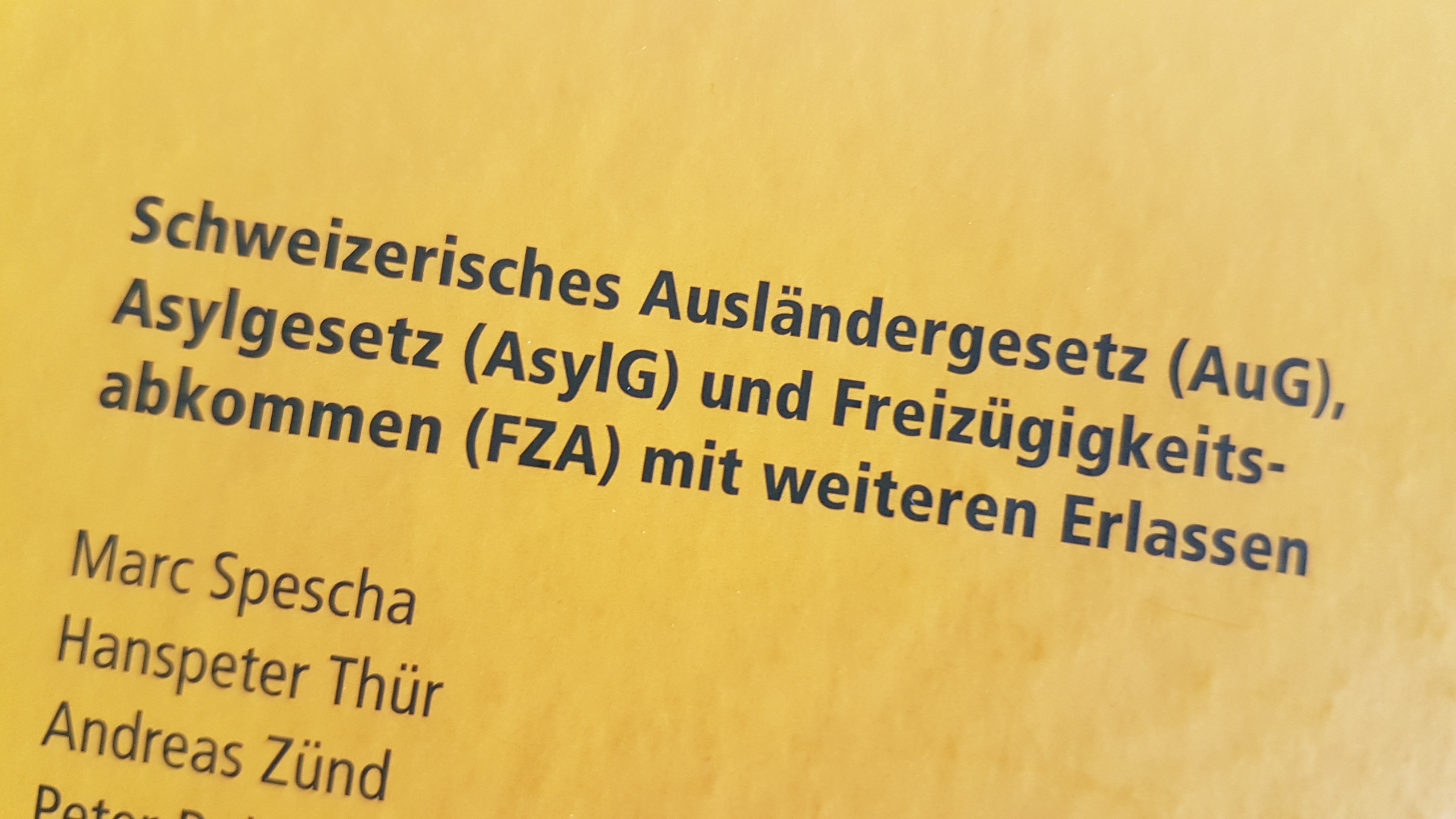Erneut können wir für eine Rentnerin eine Aufenthaltsbewilligung erwirken. Anders als im Aktuellen Fall vom 13. Oktober 2022 handelt es sich um eine Staatsangehörige aus der EU. Aus diesem Grund gehen die staatsvertraglichen Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens und seiner Anhänge vom 21. Juni 1999 (FZA) und der gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen dem Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) vor (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG).
Das MIKA erteilt auf Einsprache hin (vgl. § 7 f. Einführungsgesetz zum Ausländerrecht [EGAR]) die Bewilligung. Diese begründet es indessen nicht auf Art. 24 Anhang I des FZA und der Ausführungsbestimmung in Art. 16 der Verordnung über den freien Personenverkehr (VFP), wonach eine Staatsangehörige der EU subsidiär ohne Ausübung einer Erwerbstätigkeit eine Aufenthaltsbewilligung erhält, wenn sie über eine Krankenversicherung mit Abdeckung sämtlicher Risiken verfügt und den Nachweis erbringt, dass sie für sich selbst und ihre Familienangehörigen über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, so dass sie nicht Sozialhilfe beziehen muss.
Vielmehr erteilt das MIKA die Bewilligung aus wichtigen Gründen gestützt auf Art. 20 VFP und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG sowie Art. 31 VZAE. Insbesondere berücksichtig das Amt die gute Integration der Gesuchstellerin, ihre familiären Beziehungen zu den erwachsenen Kindern in der Schweiz und ihre frühere Aufenthaltsdauer von fast 20 Jahren mit entsprechender Einzahlung in die Vorsorgeeinrichtungen. Außerdem weist das Amt zu Recht darauf hin, dass bei den knappen finanziellen Mitteln zwar eine latente EL-Berechtigung bestehe, eine solche jedoch auch bei einer Niederlassungsbewilligung bestünde.
vgl. auch Ziff. 6 der Weisungen VFP.