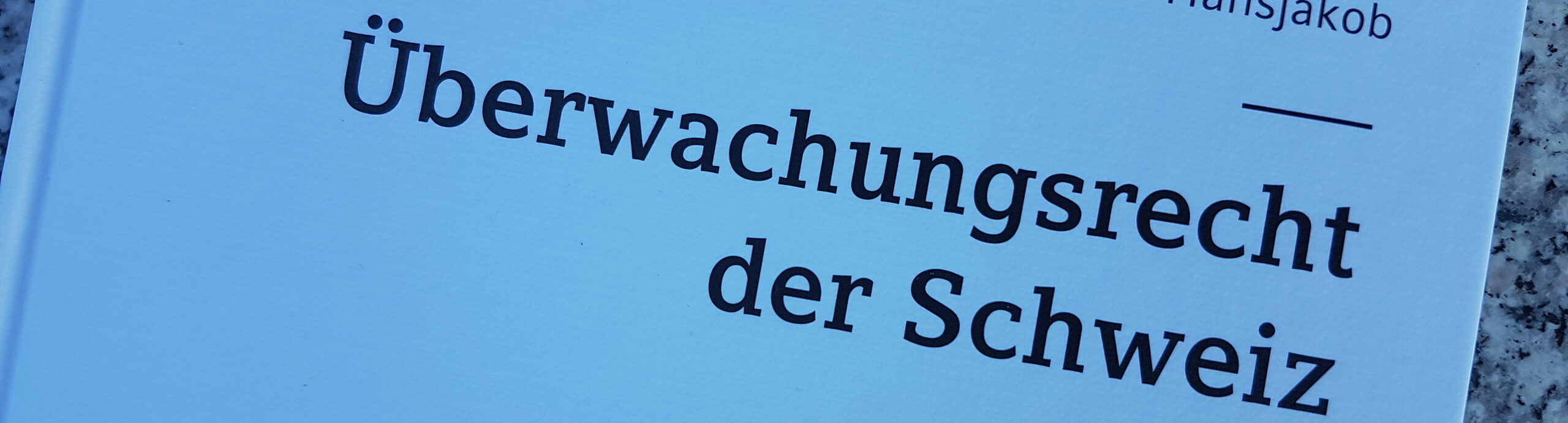Die Strafprozessordnung sieht in Art. 269 ff. StPO geheime Überwachungsmaßnahmen zur Aufklärung schwerer Straftaten vor. Die organisatorischen und technischen Bestimmungen dazu finden sich im Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF).
So kann bei dringendem Tatverdacht hinsichtlich einer der aufgeführten Straftaten (Katalogtat; Art. 269 Abs. 2 StPO) die Telekommunikation aktiv in Echtzeit überwacht werden, soweit die Tatschwere dies als verhältnismäßig erscheinen lässt und bisherige Maßnahmen nicht erfolgreich waren. Diese einschneidende Maßnahme wird in der Schweiz relativ häufig angeordnet, 60x häufiger pro 100.000 Einwohner als in den USA, aber nur halb so oft wie in Italien mit seinem spezifischen Mafia-Problem. Die Staatsanwaltschaft muss das Zwangsmaßnahmengericht maximal 24 Stunden nach der Anordnung um Genehmigung ersuchen. Das Zwangsmaßnahmengericht muss die Überwachung innerhalb von 5 Tagen seit deren Anordnung genehmigen (vgl. Art. 272 und Art. 274 StPO). Die Maßnahme muss dem Betroffenen spätestens am Ende des Vorverfahrens mit der Parteimitteilung nach Art. 318 StPO mitgeteilt werden, was ihm die Beschwerdemöglichkeit eröffnet (Art. 279 StPO). Ob und wieweit die Unverwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnis bei unterlassener Beschwerde auch noch im Hauptverfahren geltend gemacht werden kann, ist umstritten. Die Rechtmäßigkeit der Maßnahme an sich kann vor dem Sachrichter nicht mehr in Frage gestellt werden, der Beweiswert der Erkenntnisse hingegen schon (vgl. Art. 279 Abs. 3 StPO; BGE 140 IV 40 ff.; Th. Hansjakob, Überwachungsrecht der Schweiz, 2017, Rz. 1310 ff.).
Die bloße Erhebung von Randdaten (mit wem, wann, wie lange und wo die überwachte Person Verbindungen hat oder bis 6 Monate rückwirkend hatte) ist hingegen gemäß Art. 273 StPO auch außerhalb der Katalogtaten, also nach den allgemeinen Regeln für Zwangsmaßnahmen grundsätzlich bei allen Vergehen und Verbrechen und sogar für die Übertretung von Art. 179septies StGB zulässig. Der Verhältnismäßigkeitsprinzip entfaltet hier eine stärkere Bedeutung.
In unserem Fall fungieren wir als notwendige amtliche Verteidigung für einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher aus Osteuropa. Die Staatsanwaltschaft fahndet aufgrund von DNA-Spuren schon seit Jahren nach dem vorbestraften Mann. Eine aktive Überwachung führt tatsächlich zum „Erfolg“: Der Mann wird im Kanton Luzern festgenommen, nachdem er seine Ankunft telefonisch, wenn auch verklausuliert, angekündigt hat.