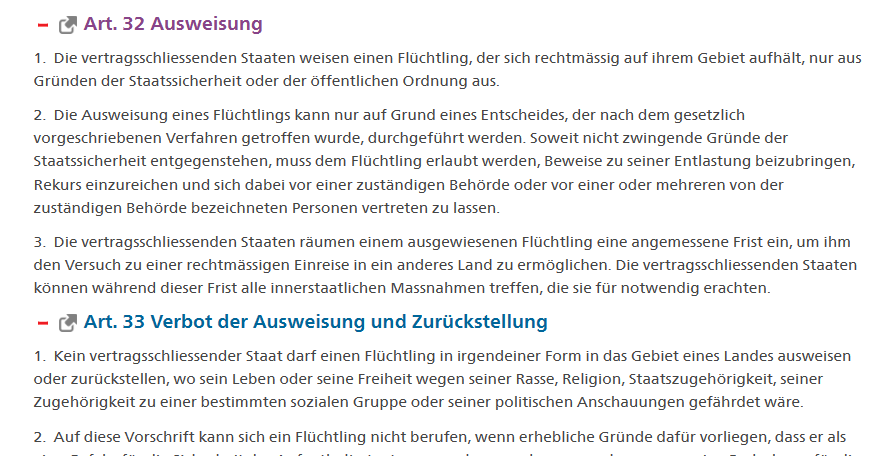Wer wegen einer sog. Katalogtat verurteilt wird, wird grundsätzlich zwingend des Landes verwiesen (vgl. Art. 66a StGB). Bei anerkannten Flüchtlingen entsteht dadurch ein potentieller Konflikt, da sie ja an sich wegen einer Verfolgung in ihrer Heimat Schutz erhalten haben sollten. Dennoch steht die Flüchtlingseigenschaft der Anordnung der Landesverweisung nicht per se entgegen. Das Gericht muss freilich in derartigen Fällen das Vorliegen eines persönlichen Härtefalls besonders gut prüfen und die öffentlichen und privaten Interessen einander gegenüberstellen. Soweit die Verhältnisse stabil und die rechtliche (Un-)Durchführbarkeit der Landesverweisung bestimmbar ist, ist dies bereits bei der Urteilsfällung zu berücksichtigen. Völkerrechtlich in jedem Fall untersagt ist die Abschiebung in ein Land, wo das Leben oder die Freiheit des Beschuldigten wegen der Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit etc. gefährdet wäre, außer der Betroffene würde eine Bedrohung der nationalen Sicherheit oder sonst ein akute Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen (vgl. Art. 32 f. FK). Auch eine Gefährdung im Sinne des Folterverbots (vgl. Art. 3 EMRK) sowie ein möglicher Eingriff in das Recht auf Familienbeziehung (vgl. Art. 8 EMRK) sind selbstredend zu berücksichtigen. Grundsätzlich bedeutet aber eben eine Katalogtat die automatische Landesverweisung, die allenfalls später halt nicht vollzogen werden kann (vgl. Art. 66d StGB).
In unserem Fall erfolgt eine Verurteilung u.a. wegen versuchter schwerer Körperverletzung, einfacher Körperverletzung, Diebstahls, mehrfachen Hausfriedensbruchs, Drohung, mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte etc. Da damit einerseits eine (mittlere) Gefahr für die öffentliche Ordnung der Schweiz erstellt und andererseits gleichzeitig keine konkrete Gefährdung des Beschuldigten in seiner Heimat glaubhaft gemacht ist, ist die Landesverweisung auszusprechen. Zudem verfügt der Beschuldigte über keinerlei Bezugspunkte zur Schweiz, hat insbesondere keine familiären Beziehungen.
Die Bundesbehörden gewährten dem Beschuldigten seinerzeit erstaunlicherweise ohne vertiefte Prüfung und ohne Begründung Asyl. Dies und der Umstand, dass der Beschuldigte im Asylverfahren lediglich den Wunsch geäußert hatte, hierzulande ein neues Leben aufbauen wolle, vermag somit nichts an der obligatorischen Landesverweisung zu ändern.