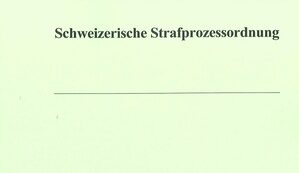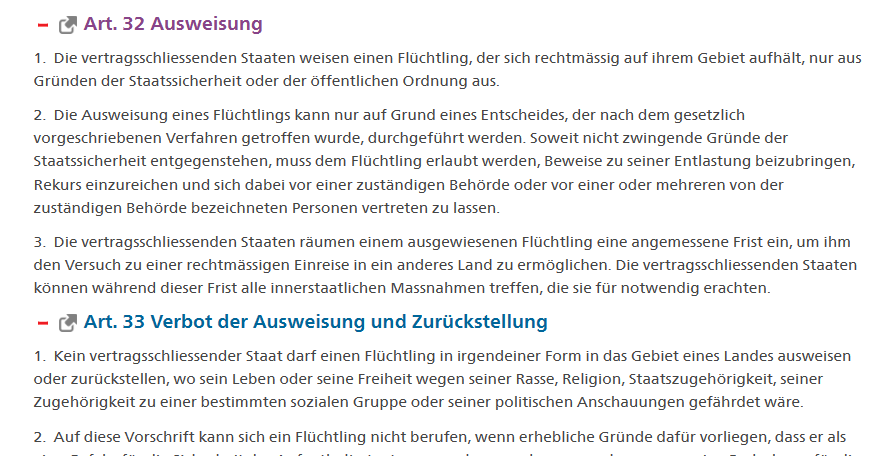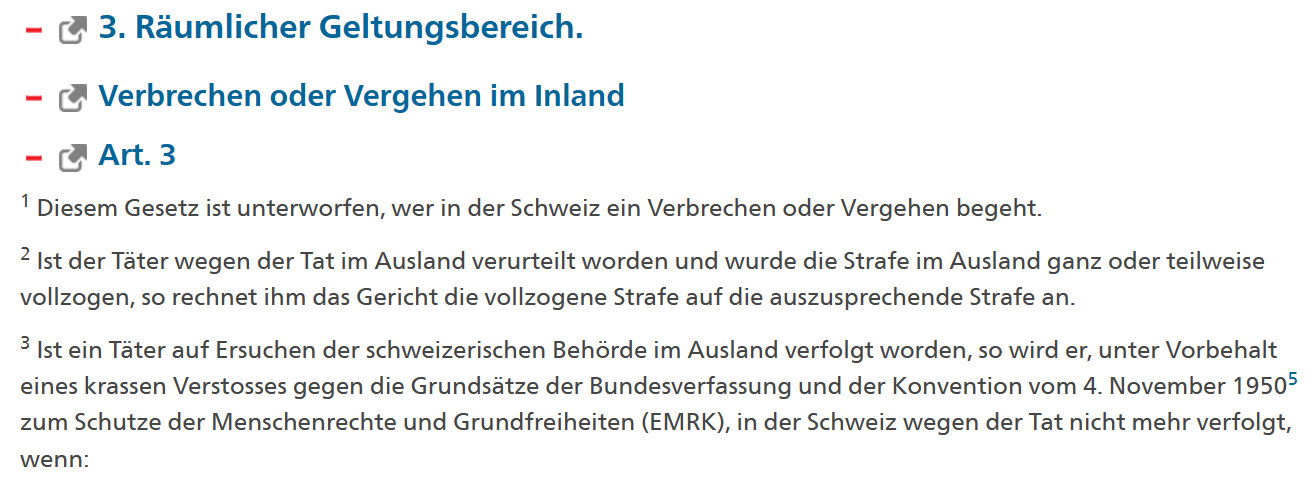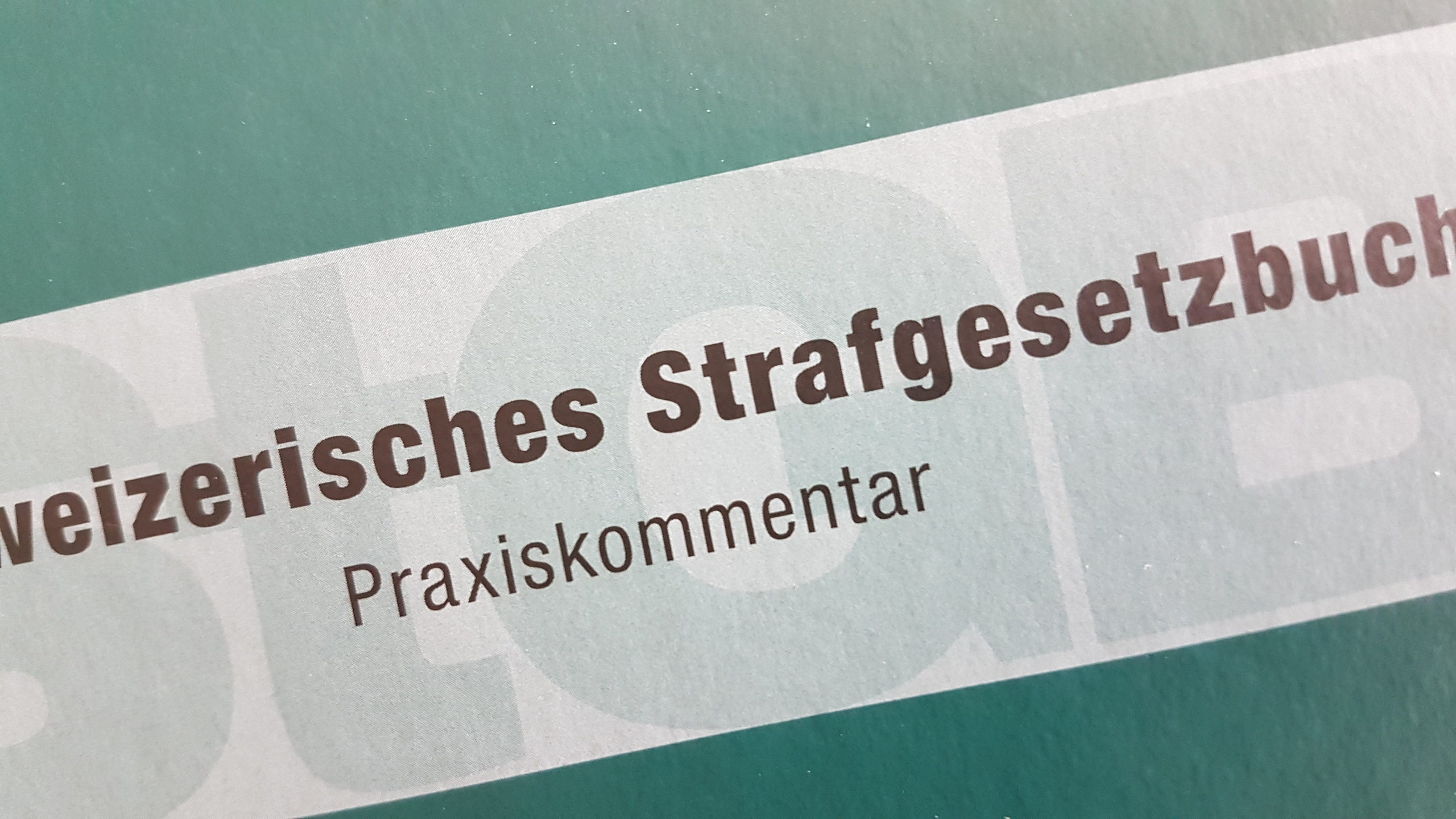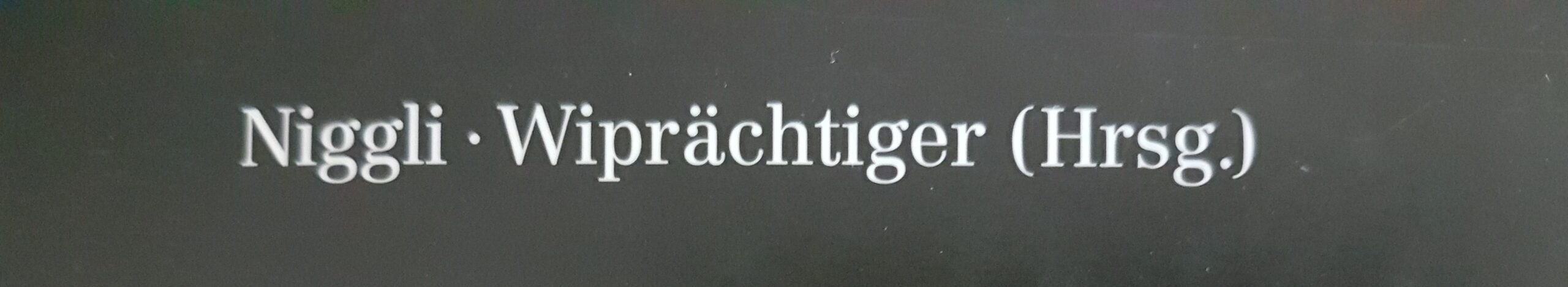Die Staatsanwaltschaft beschließt, das Vorverfahren gegen unseren Mandanten einzustellen. Weil die mutmaßlich geschädigte Person ihren Strafantrag zurückgezogen hat, kann bei den vorgeworfenen Antragsdelikten (konkret: Art. 179bis ff. StGB) eine Bestrafung nicht mehr erfolgen. Dadurch fehlt dauerhaft eine Prozessvoraussetzung (vgl. Art. 319 Abs. 1 Bst. b StPO).
Dennoch ist unser Mandant nicht ganz „reingewaschen“. Weil er durch sein Verhalten das Verfahren überhaupt erst veranlasst und die Geschädigte zum Stellen eines Strafantrags veranlasst hat, soll er einerseits einen Teil der Verfahrenskosten tragen und andererseits für seine Aufwendungen im Verfahren keine Entschädigung erhalten (vgl. Art. 426 Abs. 2 bzw. Art. 430 Abs. 1 Bst. a StPO). Diese Kostenregelung ist nicht unproblematisch und steht im Widerspruch zur Unschuldsvermutung (vgl. Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 10 Abs. 1 StPO). Dennoch ist sie zulässig, wenn man dem Beschuldigten auf der zivilrechtlichen Ebene einen Vorwurf machen kann, d.h. der Vorwurf nicht auf ein strafrechtliches Verschulden abzielt. Dem Beschuldigten muss eine Verletzung von Art. 41 OR bzw. anderer zivilrechtlicher Normen wie Art. 28 ZGB oder weiterer Verhaltensnormen vorgeworfen werden können. Sein Verhalten muss das Strafverfahren veranlasst oder erschwert haben. Dabei darf sich die Kostenauflage lediglich auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (vgl. Bundesgerichtsurteil 6B_1394/2021, E. 2.2; BGE 144 IV 202, E. 2.2).
Vgl. auch „Verwirkt der Entschädigungsanspruch des Freigesprochenen? „(Blogg 13. Juni 2021)