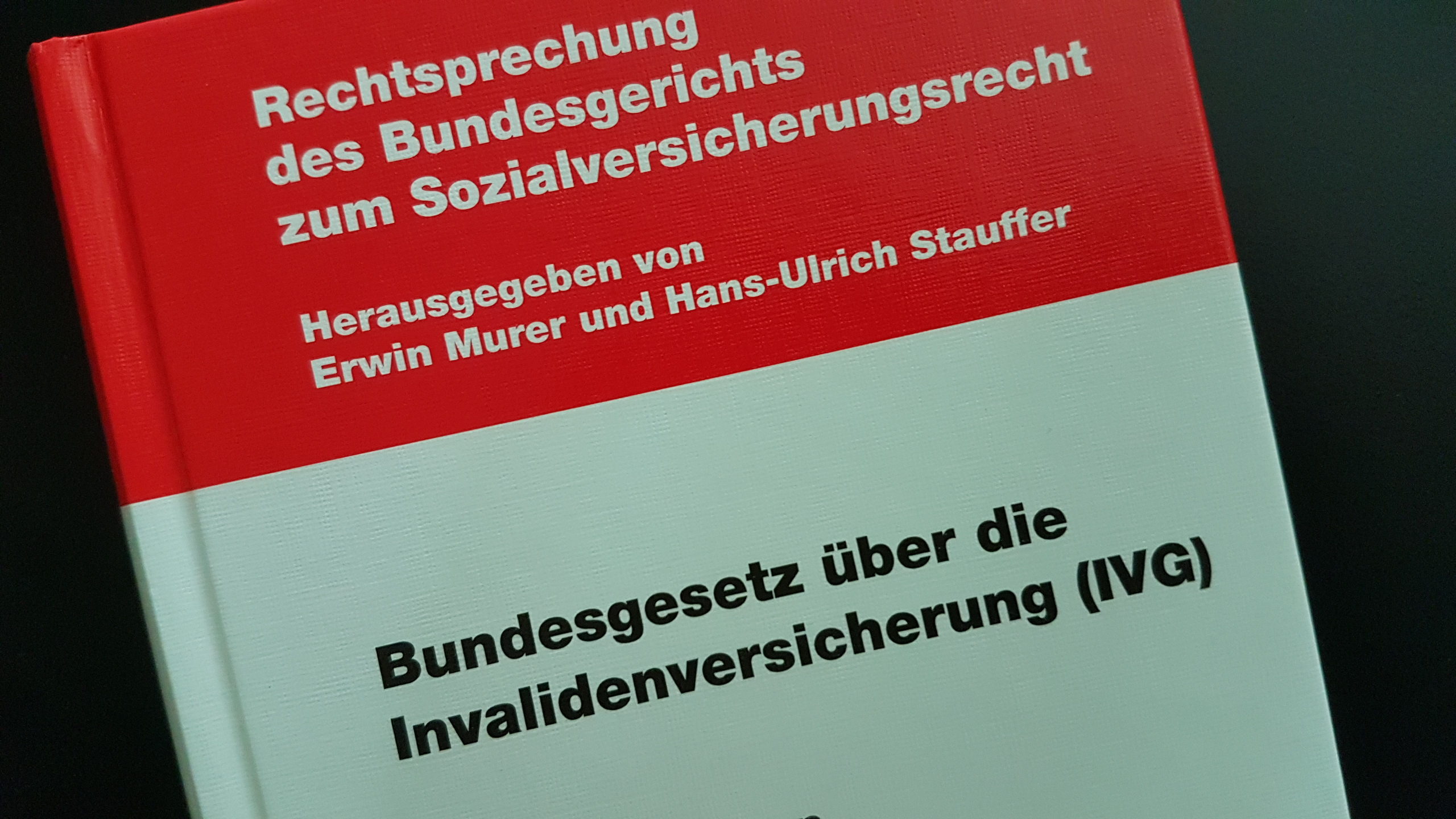Bei der Ermittlung des Invalideneinkommens verwendet die Invalidenversicherung (IV) Tabellenlöhne, wenn die versicherte Person kein effektives Erwerbseinkommen mehr erzielt.
Bis vor Kurzem bezweckte dabei der sogenannte leidensbedingte Abzug (auch Leidensabzug, Behinderungsabzug oder behinderungsbedingter Abzug genannt), die Tabellenlöhne für Personen zu korrigieren, die ihre gesundheitlich bedingte Restarbeitsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur mit unterdurchschnittlich erwerblichem Erfolg verwerten können. Abzugsrechtlich relevant waren alle Einschränkungen, die zusätzlich zur medizinisch attestierten Arbeitsfähigkeit vorhanden sind (vgl. Bundesgericht, Urteil 9C_325/2013 E. 4.2; 9C_436/2011 E. 3.3).
Die Rechtsprechung definierte die einkommensbeeinflussenden Kriterien wie Lebensalter, Anzahl Dienstjahre, Nationalität/Aufenthaltskategorie und Beschäftigungsgrad. Der Abzug sollte nicht standardmäßig erfolgen und maximal 25% betragen. Die Rechtsprechung dazu war schwer zu überblicken. Die IV-Stellen verneinten regelmäßig den in ihrem Ermessen festzulegenden Abzug mit der Begründung, die Einschränkungen seien bereits im medizinisch zumutbaren Belastbarkeitsprofil enthalten. Eine gerichtliche Korrektur scheiterte oft an der Kognition (Überprüfungsumfang) der Versicherungsgerichte, da diese nicht ohne Not von der Ermessensausübung der Verwaltung abweichen, und die Kognition des Bundesgerichts war auf Willkürprüfung beschränkt.
Mit der Weiterentwicklung der IV, in Kraft seit 01. Januar 2022, wird der Leidensabzug aufgegeben und durch neue Korrekturfaktoren ersetzt. Neu wird von funktioneller Leistungsfähigkeit (vgl. Art. 54a Abs. 3 IVG; Art. 49 Abs. 1bis IVV) gesprochen und ein Teilzeitabzug gewährt (vgl. Art. 26bis Abs. 3 IVV).
Bei der Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit ist die medizinisch attestierte Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit und für angepasste Tätigkeiten unter Berücksichtigung sämtlicher physischen, psychischen und geistigen Ressourcen und Einschränkungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen und zu begründen. Mit dem neuen Regime sollen nun jegliche durch die Invalidität bedingte quantitative und qualitative Einschränkungen bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit (z.B. erhöhter Pausenbedarf, Belastungslimiten, Verlangsamungen, etc.) berücksichtigt sein. Die ärztlich festgestellte funktionelle Leistungsfähigkeit wird künftig wohl eher tiefer ausfallen, als das bisher der Fall war. Eine Beschränkung auf 25%, wie das beim Leidensabzug der Fall war, fällt weg.
Kann die versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität nur noch mit einer funktionellen Leistungsfähigkeit von 50 % oder weniger tätig sein, werden vom statistisch bestimmten Wert 10 % für Teilzeitarbeit abgezogen.
Die Abzüge fallen nicht mehr ins Ermessen der IV-Stelle und können nun leichter gerichtlich überprüft werden.