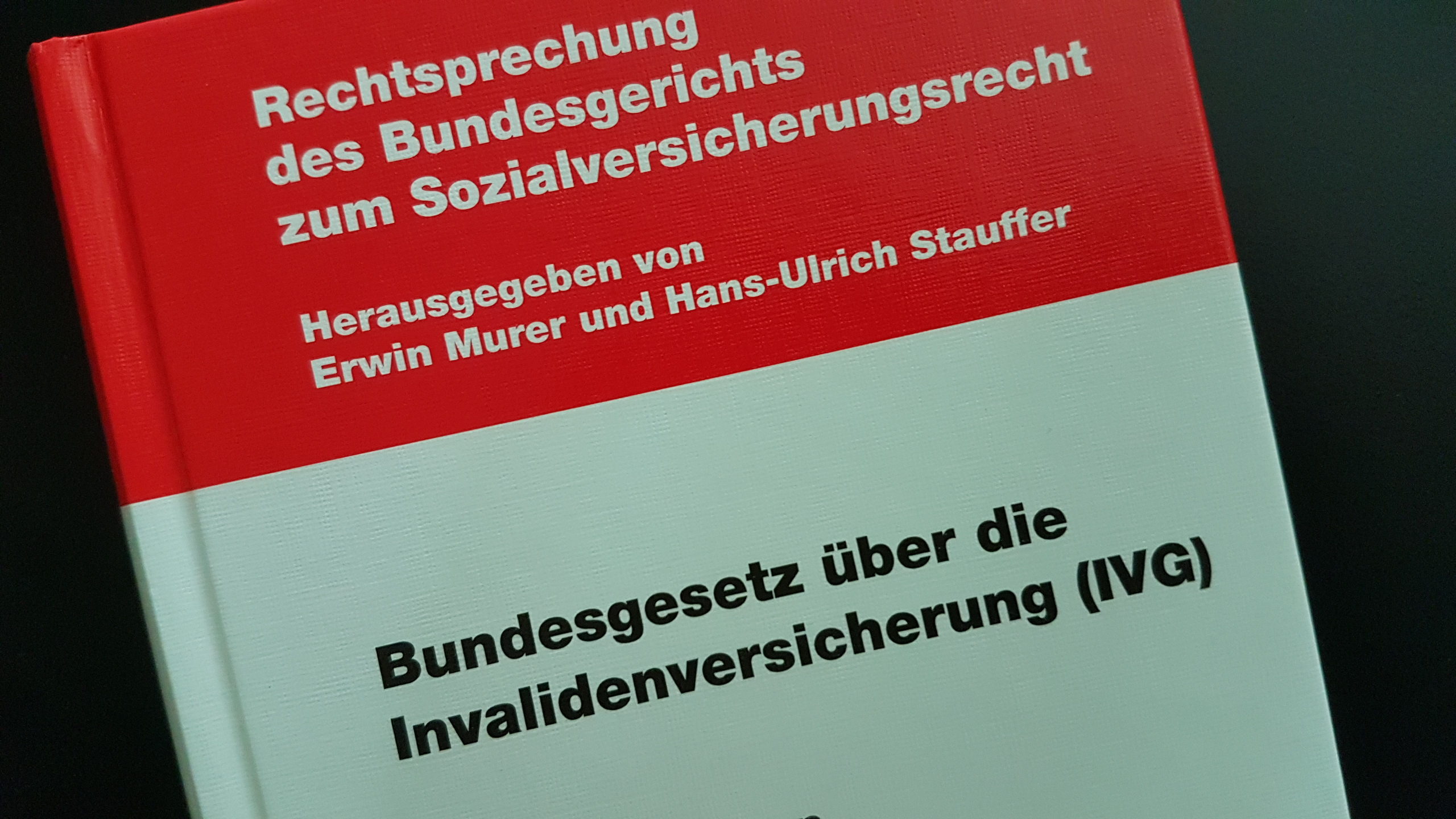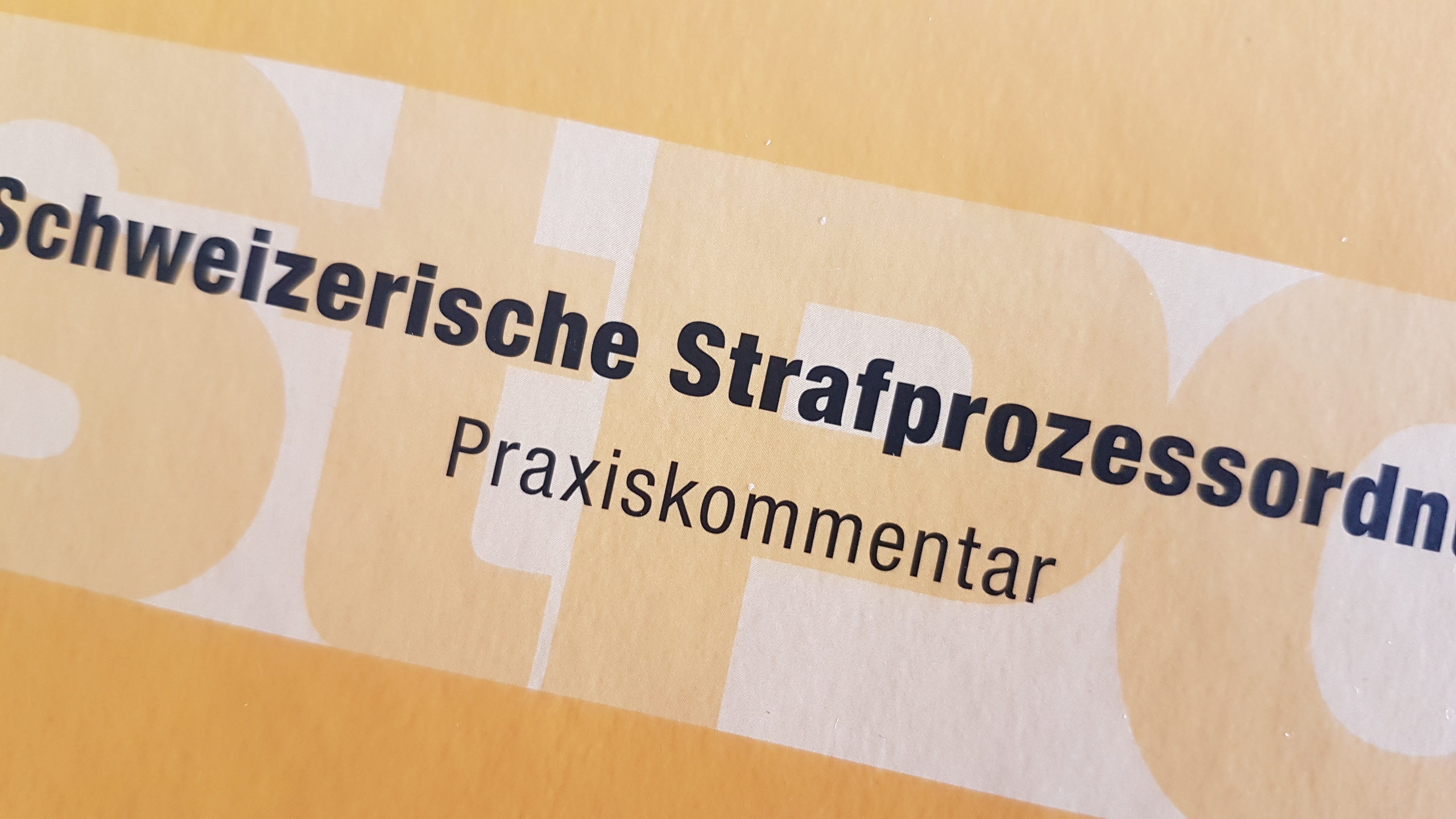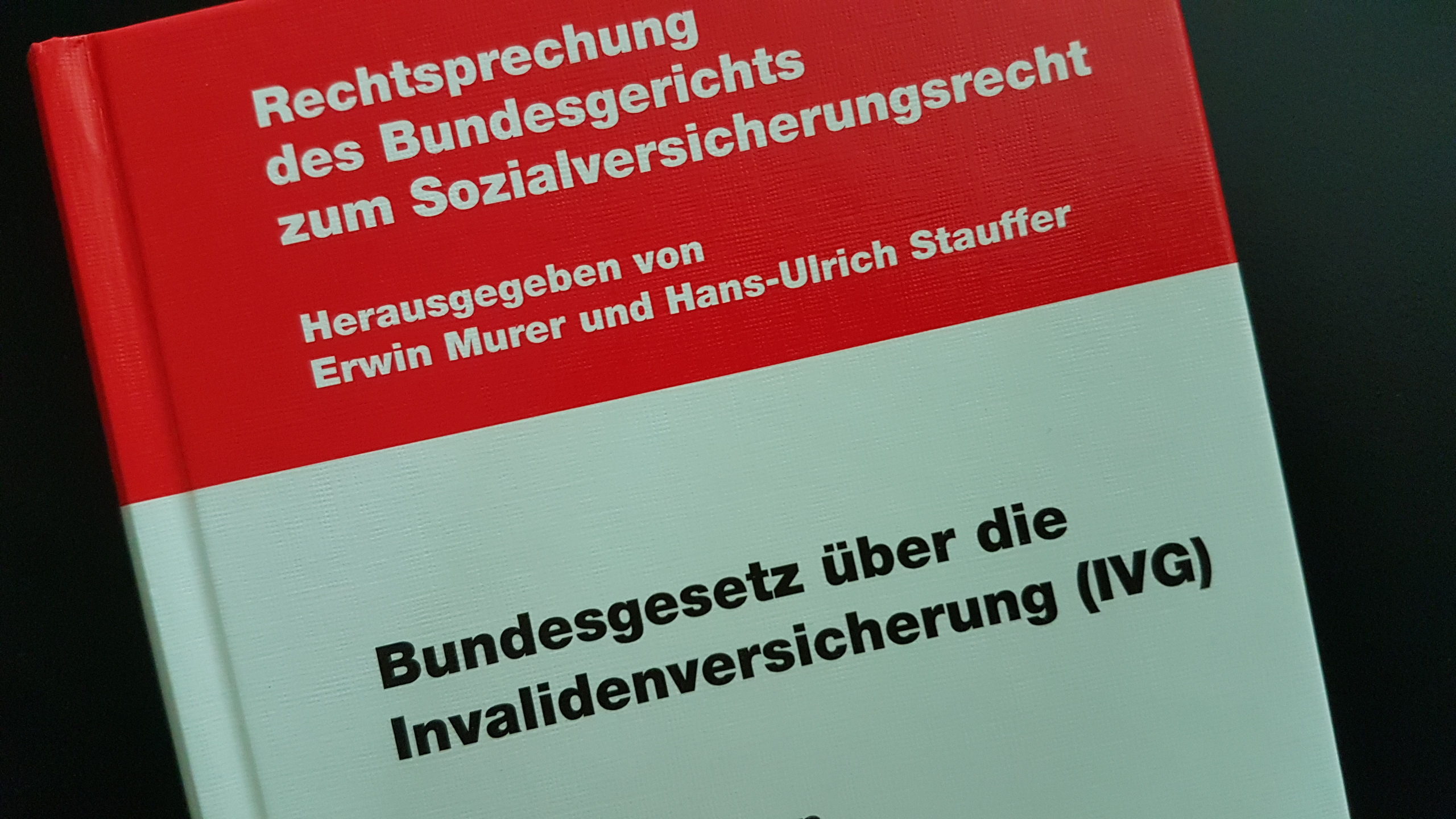Eine Suchterkrankung führte bisher nicht zu einem Rentenanspruch gegenüber der Invalidenversicherung. Relevant wurde die Sucht erst, wenn sie eine Krankheit oder einen Unfall bewirkte oder die Folge eines solches Ereignisses war, so dass die Erwerbsfähigkeit beeinträchtig wurde.
Diese Rechtsprechung wurde mit Bundesgerichtsurteil 9C_724/2018 vom 11. Juli 2019 aufgegeben. Neu sind nachvollziehbar diagnostizierte Abhängigkeitssyndrome bzw. Substanzkonsumstörungen grundsätzlich als invalidenversicherungsrechtlich beachtliche psychische Gesundheitsschäden versichert. Die Diagnose allein genügt für einen Rentenanspruch aber nicht. Vielmehr sind die Auswirkungen des bestehenden Gesundheitsschadens auf die funktionelle Leistungsfähigkeit im Einzelfall für die Rechtsanwendenden nachvollziehbar ärztlich festzustellen (Art. 7 Abs. 2 ATSG; BGE 143 V 409, 412 f. E. 4.2.1 mit Hinweisen). Die Frage nach den Auswirkungen sämtlicher psychischer Erkrankungen auf das funktionelle Leistungsvermögen ist grundsätzlich unter Anwendung des strukturierten Beweisverfahrens zu beantworten (BGE 141 V 281 ff.). Hierzu gehören auch Abhängigkeitssyndrome. Dabei muss insbesondere dem Schweregrad der Abhängigkeit im konkreten Einzelfall Rechnung getragen werden. Zudem muss eine krankheitswertige Störung muss umso ausgeprägter vorhanden sein, je stärker psychosoziale oder soziokulturelle Faktoren das Beschwerdebild mitprägen (BGE 127 V 294, 229 E. 5a).
Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann immerhin dort von einem strukturierten Beweisverfahren abgesehen werden, wo es nicht nötig oder geeignet ist. Es bleibt dann entbehrlich, wenn für eine länger dauernde Arbeitsunfähigkeit (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) keine Hinweise bestehen oder eine solche im Rahmen beweiswertiger fachärztlicher Berichte in nachvollziehbar begründeter Weise verneint wird und allfälligen gegenteiligen Einschätzungen mangels fachärztlicher Qualifikation oder aus anderen Gründen kein Beweiswert beigemessen werden kann (BGE 143 V 409, 417 E. 4.5.3).