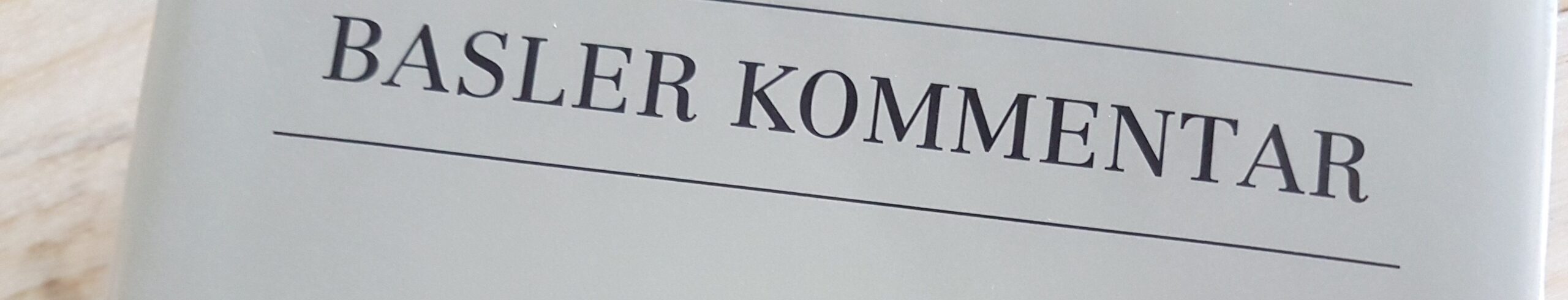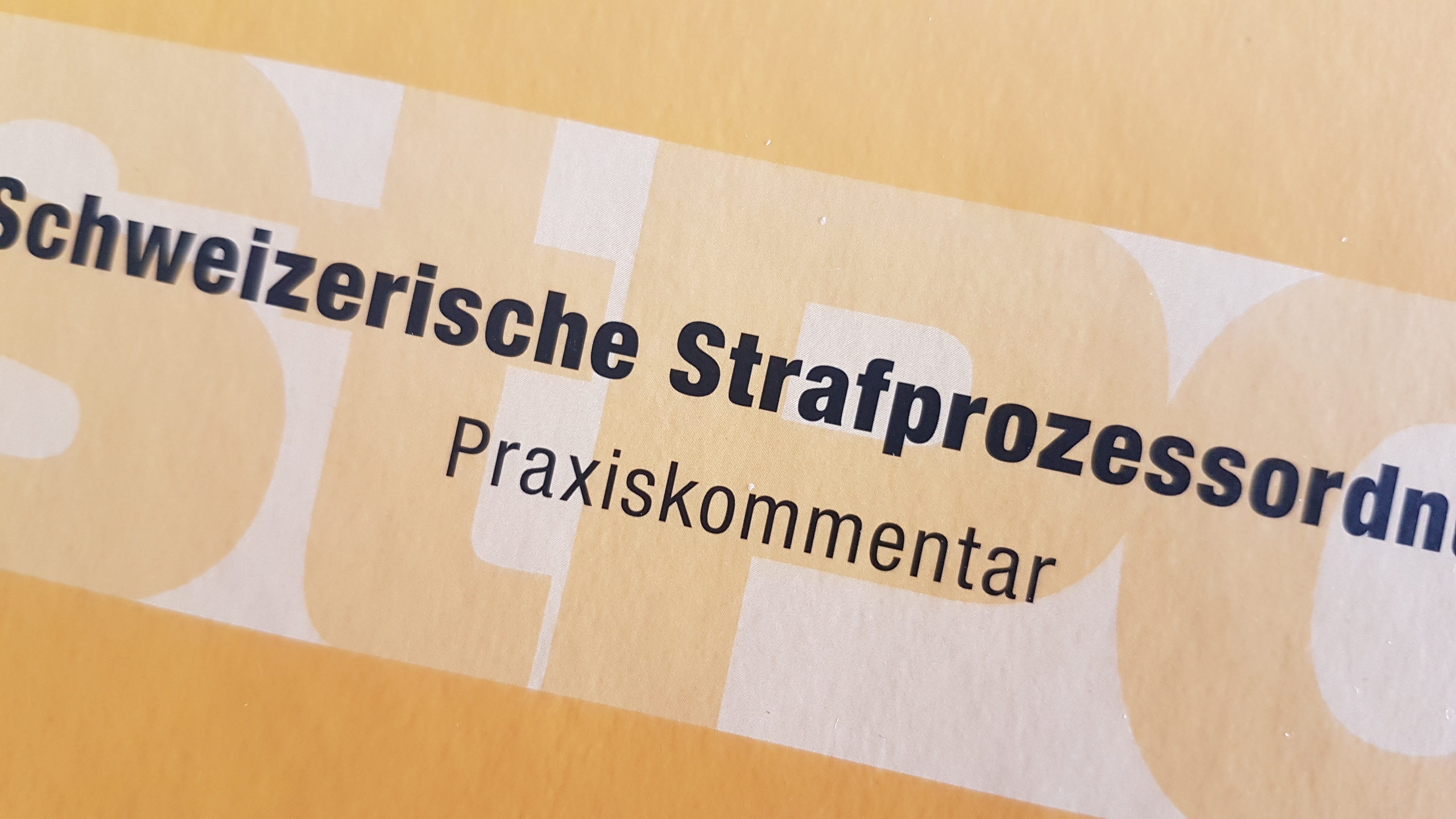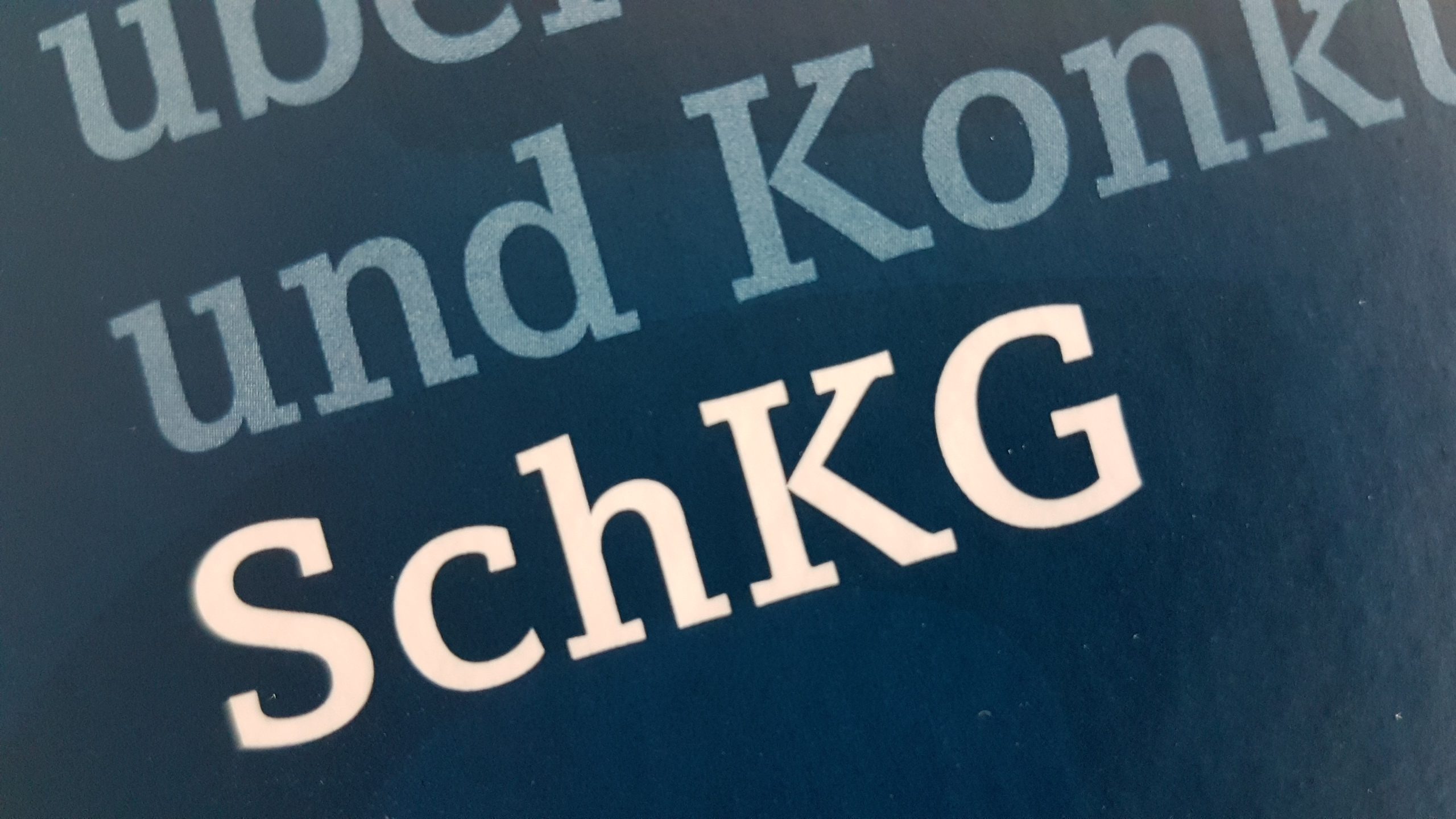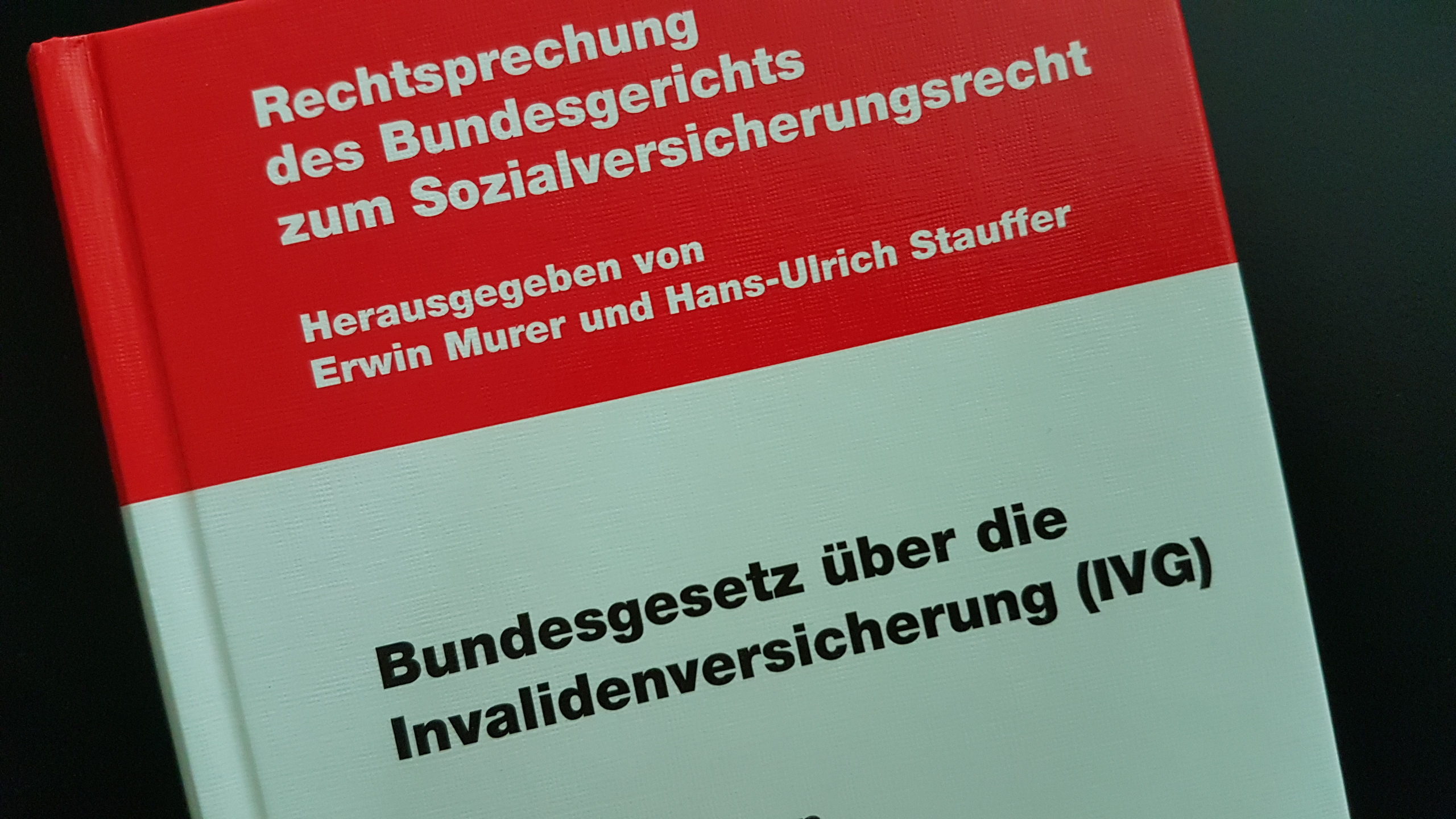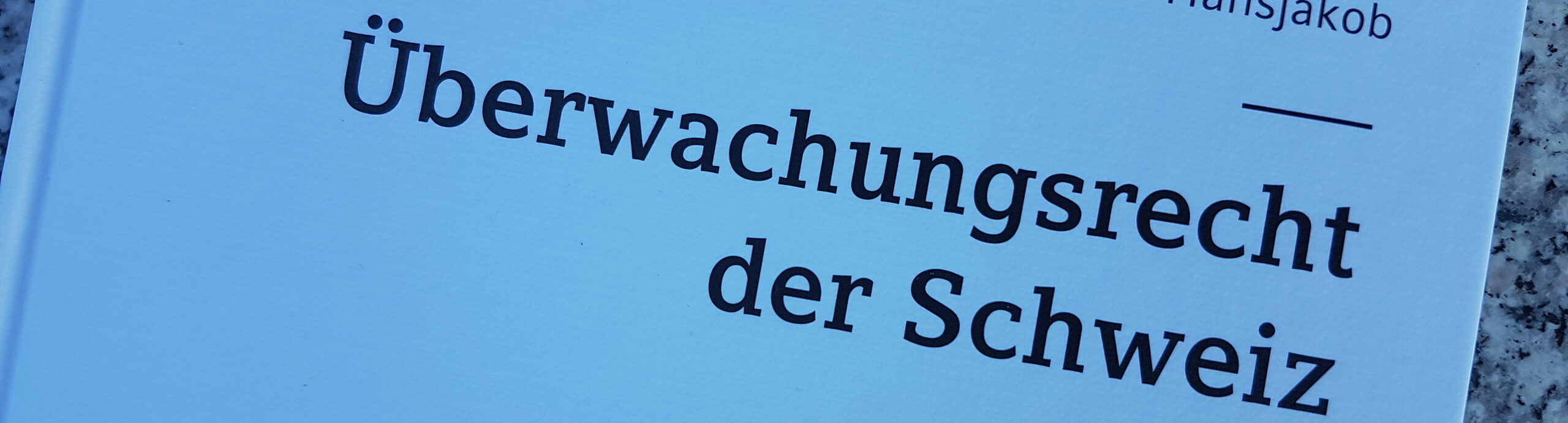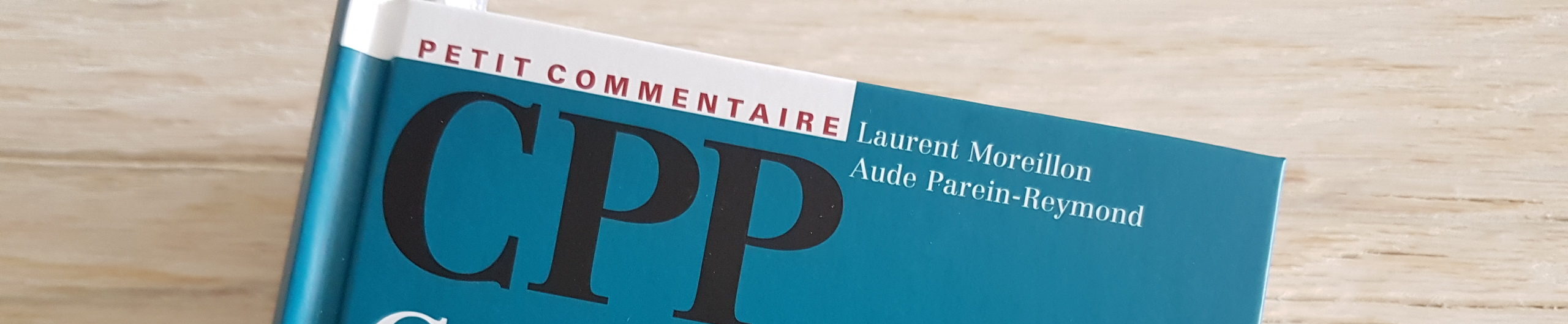Das Bundesgericht hat im Entscheid 4A_362/2018 vom 5. Oktober 2018 eine alte Streitfrage in der unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. Art. 117 ff. ZPO) entschieden. Bezieht ein Betroffener sein Pensionskassengeld als Kapital, so ist dieses voll (bzw. abzüglich des sog. Notgroschens) als Vermögen zu berücksichtigen. Ein Teil der Lehre und die meisten Gerichte hatten sich bislang auf den Standpunkt gestellt, der Vorsorgezweck der 2. Säule verböte es, das Geld anzurechnen. Das Kapital sei deshalb umgewandelt als lebenslange Rente als Einkommen zu berücksichtigen.
Das Bundesgericht verwirft etwa den Einwand, das Kapital sei betreibungsrechtlich nur beschränkt pfändbar (vgl. Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG). Auch die Sicherstellung des Vorsorgezwecks der Kapitalabfindung ist für die obersten Richter mit Bezug auf die unentgeltliche Rechtspflege nicht entscheidend:
4.2.2. (…) Aber nur weil ein Vermögenswert im Betreibungsverfahren beschränkt gepfändet werden kann, bedeutet dies noch nicht zwingend, dass dieser Wert für die prozessuale Bedürftigkeit nicht berücksichtigt werden kann. So wird doch das Erwerbseinkommen – in der Regel die Haupteinnahmequelle des Gesuchstellers – bei der Berechnung der Bedürftigkeit unbestrittermassen als Aktivposten veranschlagt, unabhängig davon, dass dieses nach Art. 93 Abs. 1 SchKG beschränkt pfändbar ist. Sodann wird in der Lehre zu Recht davon ausgegangen, dass die beschränkte Pfändbarkeit der nach Fälligkeit ausgerichteten Rente der zweiten Säule (Art. 93 Abs. 1 SchKG) nichts daran ändere, dass diese bei der Berechnung der Mittellosigkeit für die unentgeltliche Rechtspflege als Einkommen berücksichtigt werden kann. Selbst die absolut unpfändbare Rente der ersten Säule (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG; Urteil 5A_926/2017 vom 6. Juni 2018 E. 4.3, zur Publ. vorgesehen) wird im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege nach der herrschenden Lehre zutreffend als Einkommen angerechnet (Bühler, Berner Kommentar, a.a.O., N. 19 und N. 21 zu Art. 117 ZPO; Emmel, a.a.O., N. 6 zu Art. 117 ZPO; Huber, a.a.O., N. 29 zu Art. 117 ZPO; Meichssner, a.a.O., S. 82; Daniel Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, Rz. 234; a.M. wohl Jent-Sorensen, a.a.O., N. 22 zu Art. 117 ZPO, nach der nicht zur Finanzierung von Rechtspflegekosten verwendet werden müsse, was nach Art. 92 SchKG unpfändbar sei).
4.2.3. Die nach Eintritt des Versicherungsfalls ausbezahlte Kapitalabfindung der zweiten Säule dient zwar nach der gesetzlichen Konzeption der Vorsorge, bei Eintritt des Altersrentenfalls mithin der Bestreitung des Lebensunterhalts. Nur weil mit dem ausbezahlten Pensionskassenvermögen die Vorsorge bezweckt wird, ist dieser Vermögenswert aber nicht ohne Weiteres bei der Berechnung der Mittellosigkeit nach Art. 117 lit. a ZPO als Vermögen auszunehmen. Mit der Auszahlung des Pensionskassenguthabens und dem Übergang in das Privatvermögen des Versicherten kann dieser grundsätzlich frei darüber verfügen. Es ist also nicht gesetzlich sichergestellt, dass der Versicherte das ausbezahlte Kapital nur für den Vorsorgefall verwenden wird. Auch die Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege in der ZPO dienen nicht der Erhaltung des Vorsorgeschutzes des ausbezahlten Pensionskassenkapitals. Wenn sodann davon ausgegangen würde, dass ein Vermögenswert, welcher der Vorsorge gewidmet wäre, bei der Beurteilung der Bedürftigkeit nicht als Vermögen berücksichtigt werden könnte, müssten konsequenterweise auch andere Vermögenswerte im Vermögen unberücksichtigt bleiben (…).
Weiter weist das Bundesgericht auf die Wahlfreiheit des Betroffenen hin, der zwischen einer Rente oder dem Kapital entscheiden kann. Bei der Berechnung der Mittellosigkeit sind aber die beiden Arten nicht gleich zu behandeln. Entweder wird die Rente als Einkommen angerechnet oder eben das bezogene und bei Gesuchseinreichung vorhandene Kapital:
4.2.1. Die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen der zweiten Säule werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1 BVG). Der Versicherte hat aber auch grundsätzlich die Möglichkeit sich für eine Kapitalabfindung zu entscheiden (vgl. dazu: Art. 37 Abs. 2 – 4 BVG). Der Bezug des Pensionskassenvermögens als Rente oder als Kapital hat für den Versicherten verschiedene Vor- und Nachteile, die es beim Entscheid über die Modalität der Auszahlung abzuwägen gilt. Eine schematische Gleichbehandlung zwischen den Auszahlungsvarianten Rente und Kapital ist gesetzlich nicht vorgesehen. So gibt es beispielsweise Unterschiede in der steuerlichen Behandlung und auch im Falle des Todes des Versicherten stimmen die Folgen nicht überein. Auch für die unentgeltliche Rechtpflege nach Art. 117 ff. ZPO besteht kein Grund, den autonomen Entscheid des Versicherten zu negieren und für die Berechnung der prozessualen Bedürftigkeit eine hypothetische Rente anzunehmen. Mit der Gleichbehandlung mit einem Versicherten, der sich statt des Kapitalbezugs für eine Rente entschieden hat, lässt sich die Umrechnung des Kapitalbezugs in eine Rente nicht rechtfertigen.
4.2.4. Für die Berechnung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO ist grundsätzlich unerheblich, aus welcher Quelle ein Vermögenswert stammt und was mit dem Vermögenswert bezweckt werden soll. Dies gilt auch für die nach Eintritt des Versicherungsfalls ausbezahlte Kapitalabfindung aus beruflicher Vorsorge, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen der Versicherte sich für die Auszahlung des Kapitals entschied und für was er das ihm ausbezahlte Pensionskassenkapital verwenden möchte. Soweit das Vermögen des Gesuchstellers den angemessenen „Notgroschen“ übersteigt (dazu oben Erwägung 4.1), ist es ihm zumutbar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden, bevor dafür die Allgemeinheit durch öffentliche Mittel belastet wird. Es geht nicht an, öffentliche Gelder zu beanspruchen, obwohl eigentlich Vermögen vorhanden wäre, auf das zurückzugreifen der Anspruchsberechtigte aber freiwillig verzichtet (BGE 135 I 288 E. 2.4.4 S. 291). Der Gesuchsteller hat vielmehr die Prozesskosten selbst zu tragen, soweit es seine wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1 S. 136).