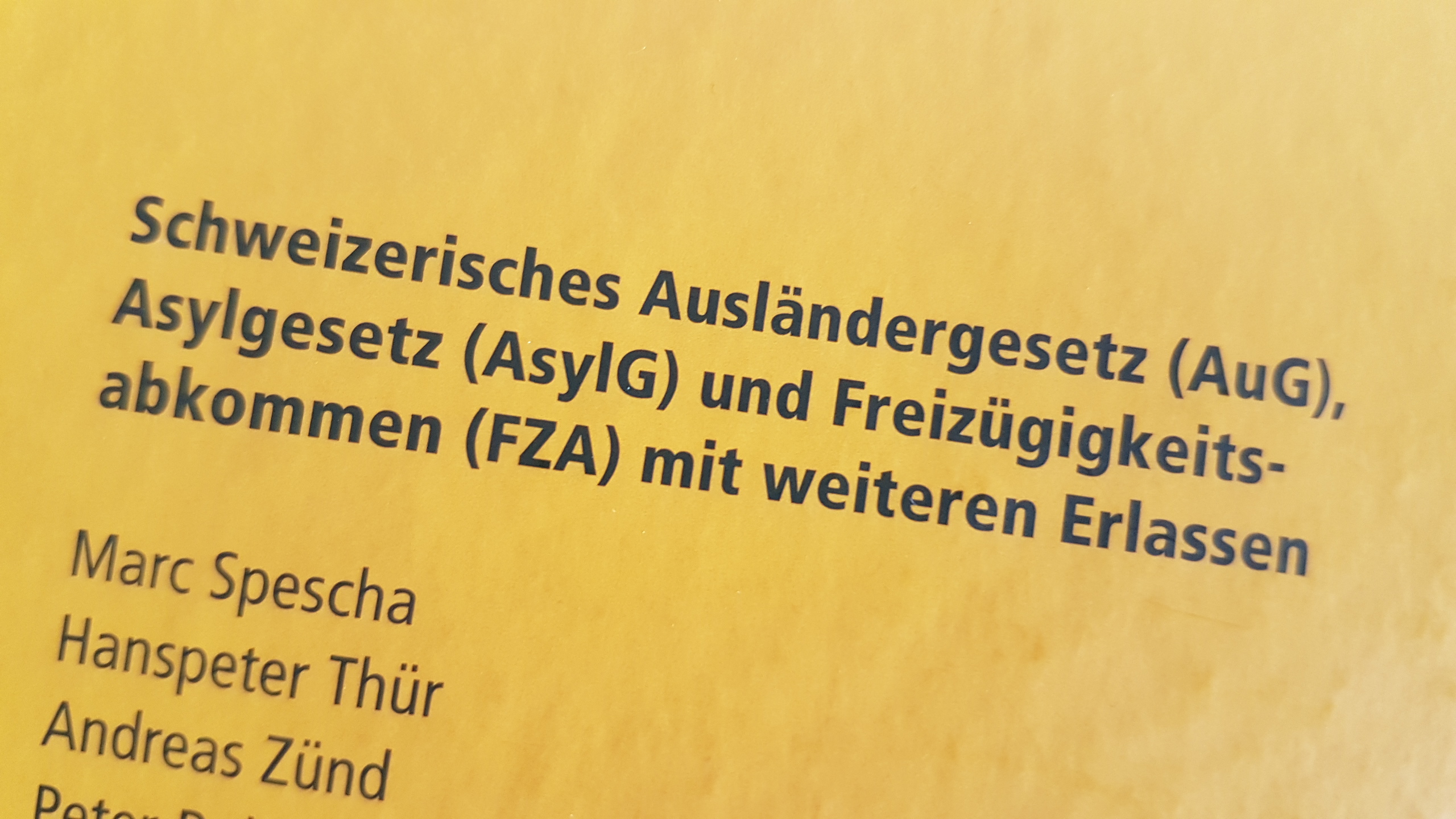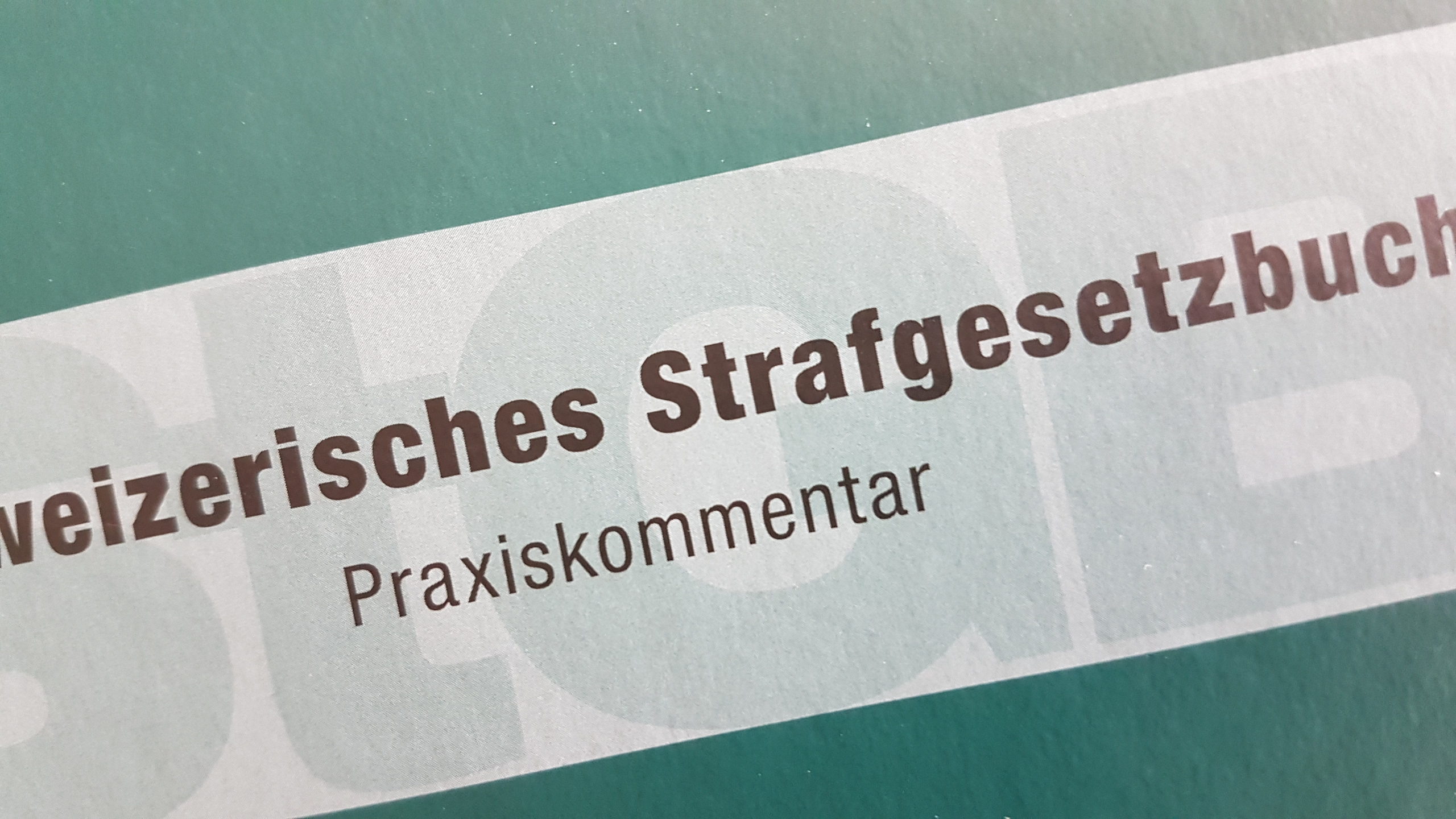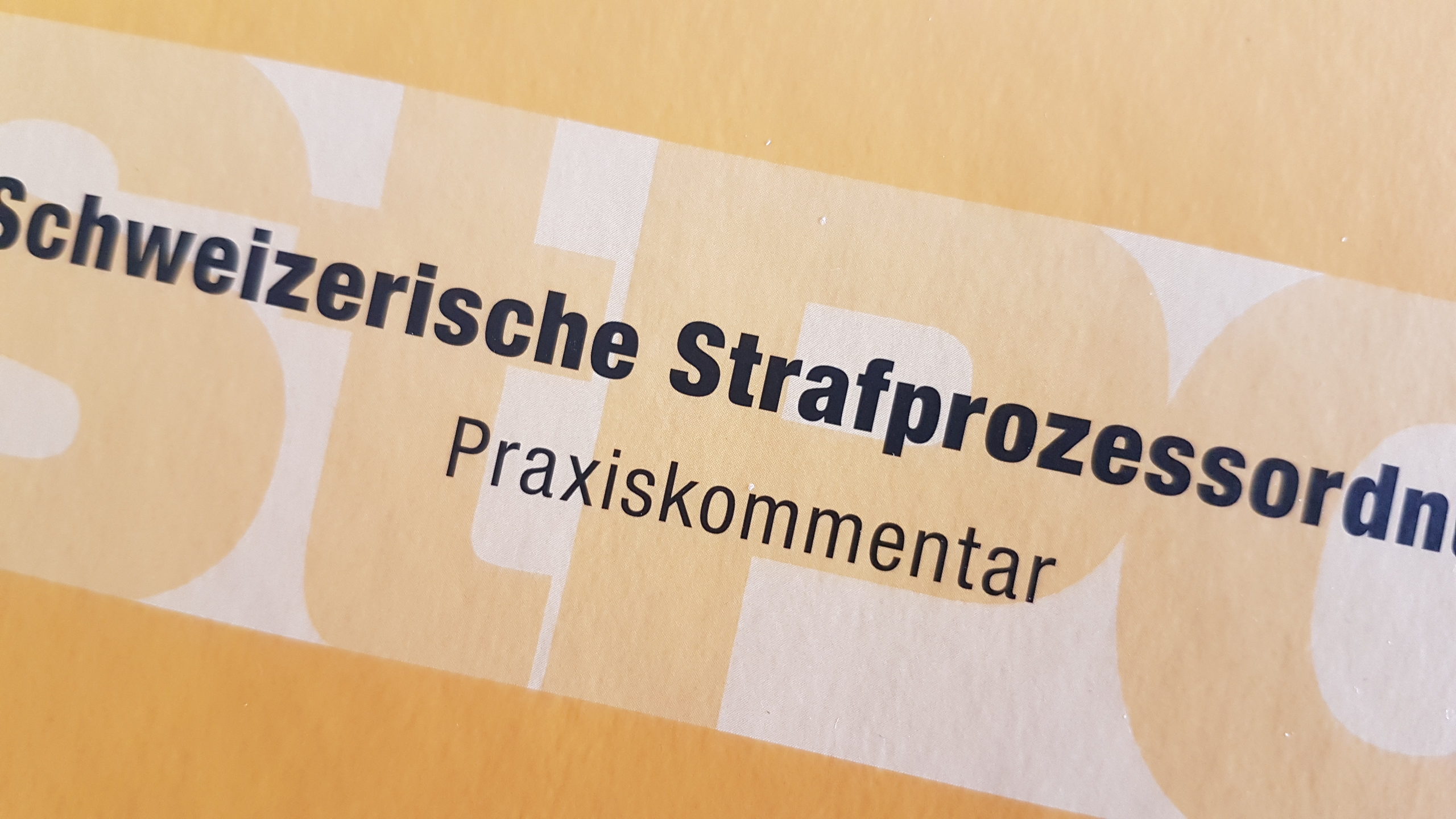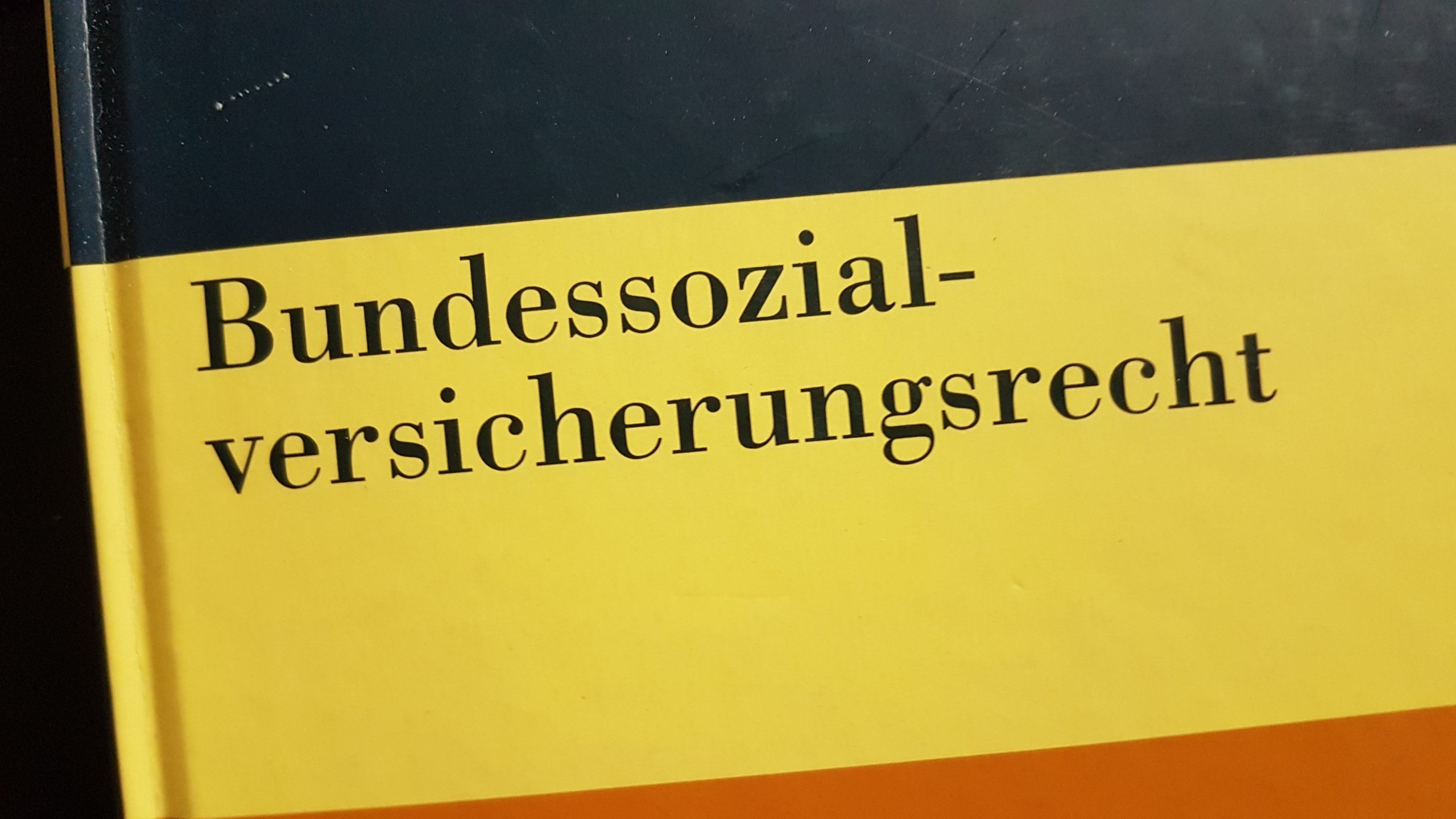Ausländer A. mit Niederlassungsbewilligung bezieht wegen eines Geburtsgebrechens eine IV-Rente und erhält zusätzlich Ergänzungsleistungen. Er heiratet in seinem Heimatland und beantragt im Oktober 2018 für seine Ehefrau als Drittstaatenangehörige eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs. Das Amt für Migration und Integration verweigert den Familiennachzug mit dem Hinweis auf den Bezug von Ergänzungsleistungen durch den nachziehenden A. (vgl. Art. 43 Abs. 1 Bst. e Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG]).
Wir setzen uns für A. zunächst erfolglos mit Einsprache (vgl. § 7 f. EGAR) und anschließend erfolgreich mit Beschwerde (vgl. § 9 EGAR; §§ 54 ff. VRPG) beim Verwaltungsgericht ein.
Dieses teilt unsere Auffassung, wonach das Gesuch vom Oktober 2018 noch nach altem Recht zu beurteilen sei, unabhängig vom Zeitpunkt des Entscheids. Entgegen der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Weisungen des SEM zum Ausländerbereich (Weisungen AIG, Ziff. 3.4.4 Fassung 01. November 2019) sei gemäß der spezialgesetzlichen Übergangsbestimmung von Art. 126 Abs. 1 AIG das Recht im Zeitpunkt der Einreichung des Familiennachzugsgesuchs maßgebend. Das bis 31. Dezember 2018 geltende Recht knüpfte den Familiennachzug noch nicht an fehlende EL-Bezüge (vgl. Art. 43 Abs. 1 AuG). Da außerdem die übrien Voraussetzung erfüllt seien, namentlich keine bestehende oder zu befürchtende Sozialhilfeabhängigkeit (vgl. Art. 62 Abs. 1 Bst. e AIG), habe A. Anspruch auf Familiennachzug.