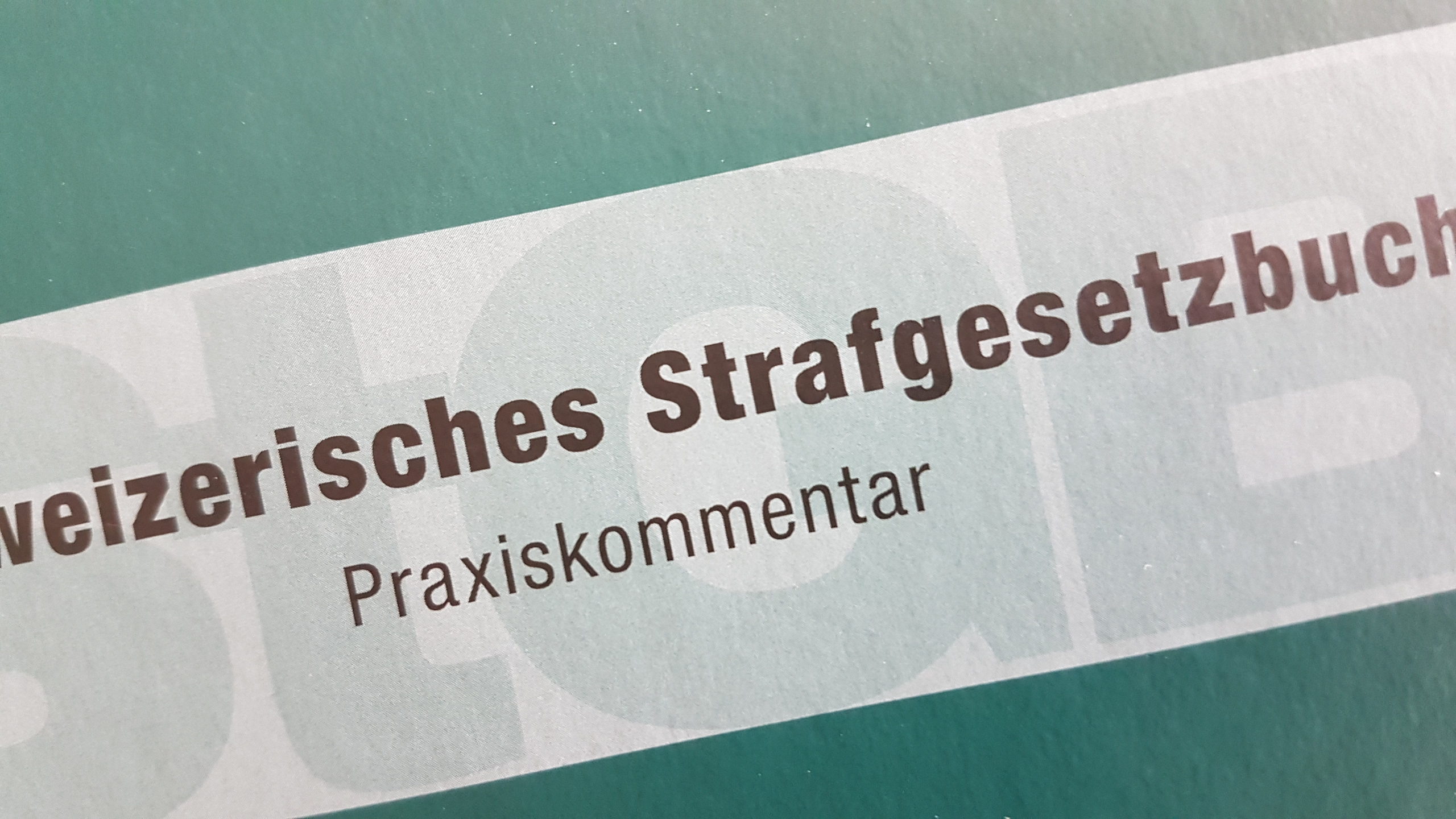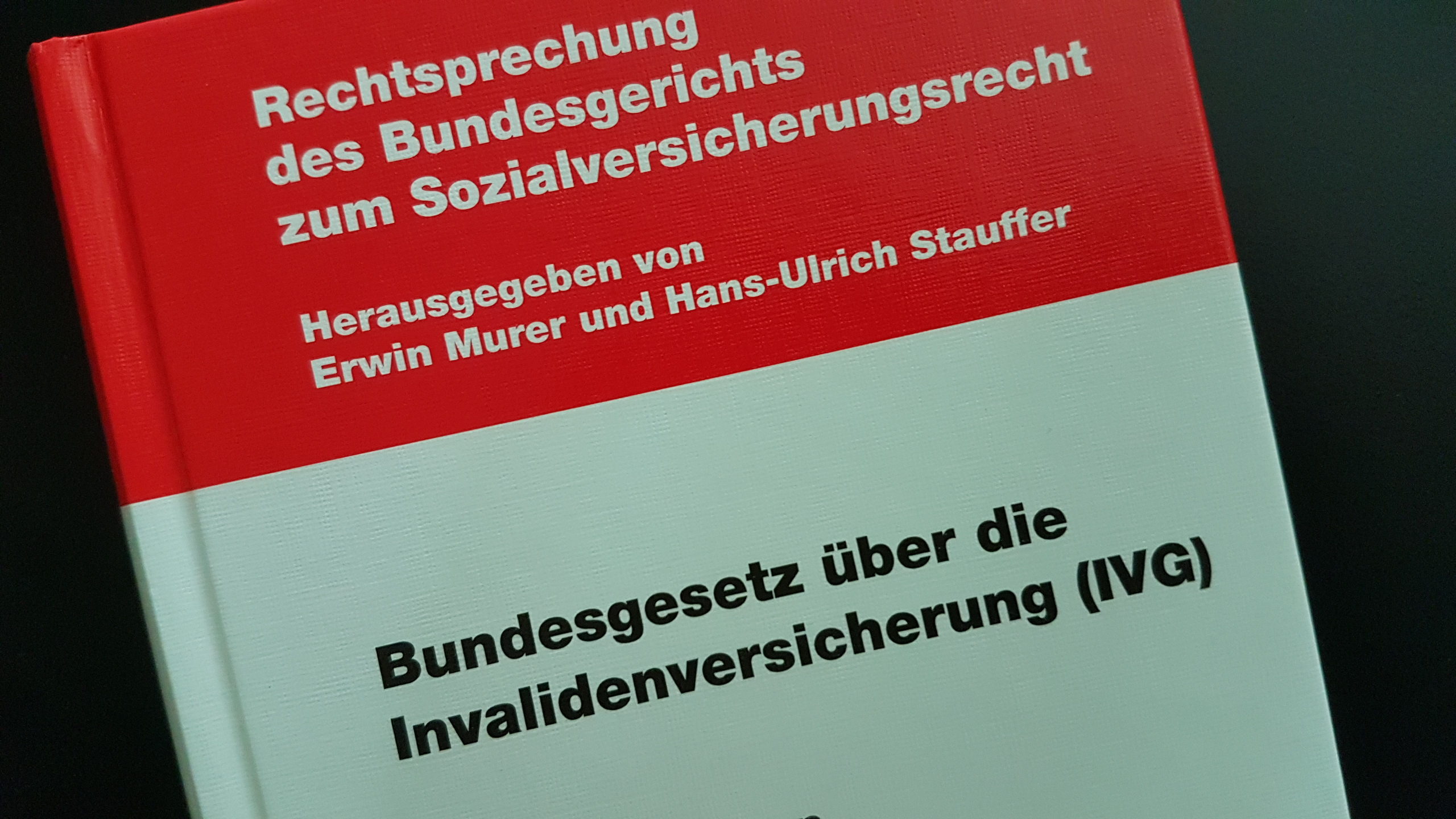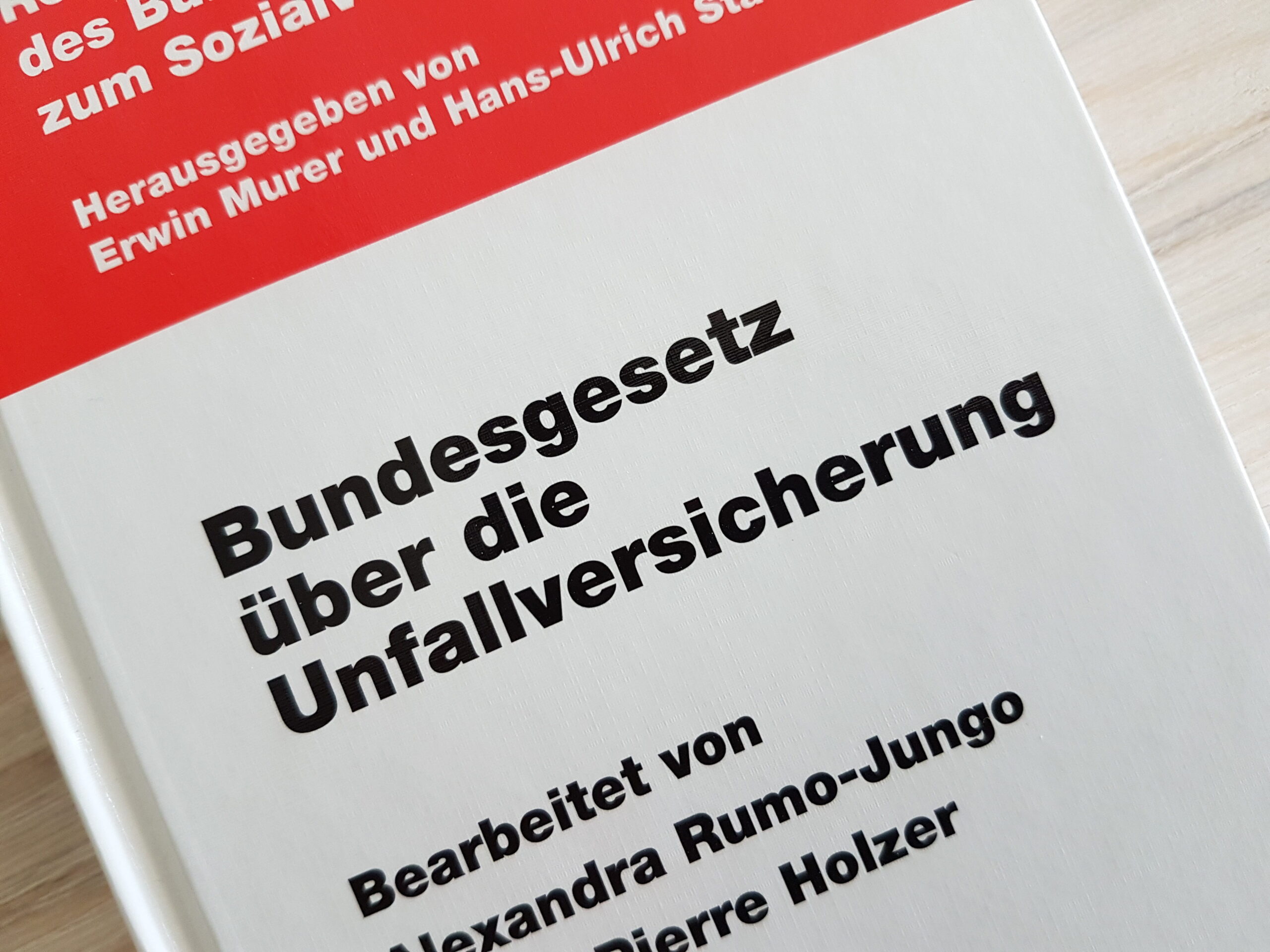In unserem aktuellen Fall konnten wir einen Beschuldigten verteidigen, welcher der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 StGB in Mittäterschaft mit seiner Partnerin angeklagt war. Die beiden sollen Gold und Geld, das die Frau von ihrem Stiefvater zur Aufbewahrung anvertraut erhalten hatten, entgegen dessen Aufforderung nicht zurückgegeben haben. Vielmehr sollen sie dem Stiefvater ein Paket mit Steinen ins Tessin geschickt haben.
Über die erstinstanzliche Hauptverhandlung berichtete auch die Zeitung (vgl. Beitrag in der Aargauer Zeitung vom 18. September 2020). Die Mitbeschuldigten argumentierten, die Stieftochter hätte die Vermögenswerte im Kontext mit familiären Problemen geschenkt erhalten, so dass gar keine Pflicht zur Rückgabe bestanden habe. Dies glaubte ihnen das Gericht jedoch nicht. Weil aber die Frau gleichzeitig aussagte, irgendwann habe sie klein beigegeben und den Mann mit der Rücksendung beauftragt, wurde sie freigesprochen. Der Mann hingegen wurde wegen unrechtmäßiger Aneignung gemäß Art. 137 Ziff. 1 StGB schuldig gesprochen. Das Gericht sah bei ihm zwar entgegen der Staatsanwaltschaft keine Treuepflicht gegenüber dem Stiefvater der Frau und verurteilte ihn deshalb aufgrund des Auffangtatbestandes von Art. 137 Ziff. 1 StGB wegen unrechtmäßiger Aneignung.
Auf Berufung hin bestätigte das Obergericht diesen Schuldspruch. Weil die Staatsanwaltschaft selbst keine Berufung eingelegt hatte, konnte das Obergericht immerhin entgegen seinem erklärten Wille keine höhere Strafe aussprechen (sog. Verschlechterungsverbot / Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 2 StPO). Das erstinstanzliche Gericht hatte „nur“ eine bedingte Geldstrafe ausgesprochen, während die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten gefordert hatte.
Sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen der unrechtmäßigen Aneignung seien, so das Berufungsgericht, beim Beschuldigten erfüllt. So habe er seinen Aneignungswillen klar kundgetan, indem er das Gold und Geld entgegen der Aufforderung seiner Frau nicht zurückgeschickte, sondern im Gegenteil weiter versteckte und die Frau im Ungewissen ließ. Der Beschuldigte habe den Geschädigten dauerhaft enteignen und sich mindestens vorübergehend bereichern wollen. Trotz des auffallend langen Zuwartens des Stiefvaters mit seiner Anzeige, des offensichtlichen Streits zwischen den Stieftöchtern, der fehlenden Belege und weiterer Widersprüche in den Aussagen des Stiefvaters gehen beide Instanzen davon aus, dass er die Vermögenswerte nicht geschenkt hatte.
Dass letztlich der Beschuldigte als Alleintäter wegen einer anderen Tat als der angeklagten zu Lasten seiner Frau verurteilt worden ist, wie wir vorbringen, verwarf das Obergericht (vgl. Anklagegrundsatz; Art. 9 StPO).