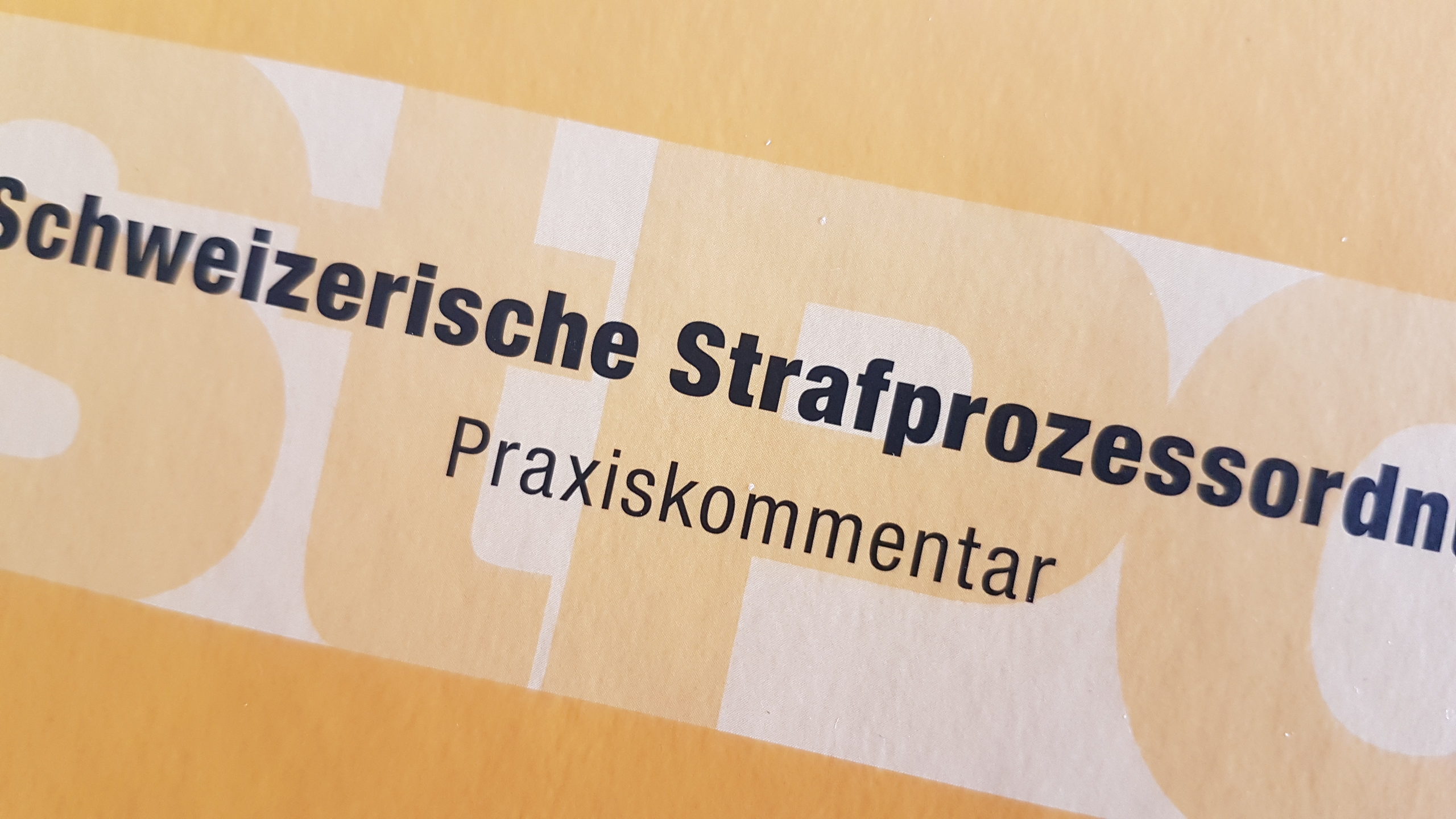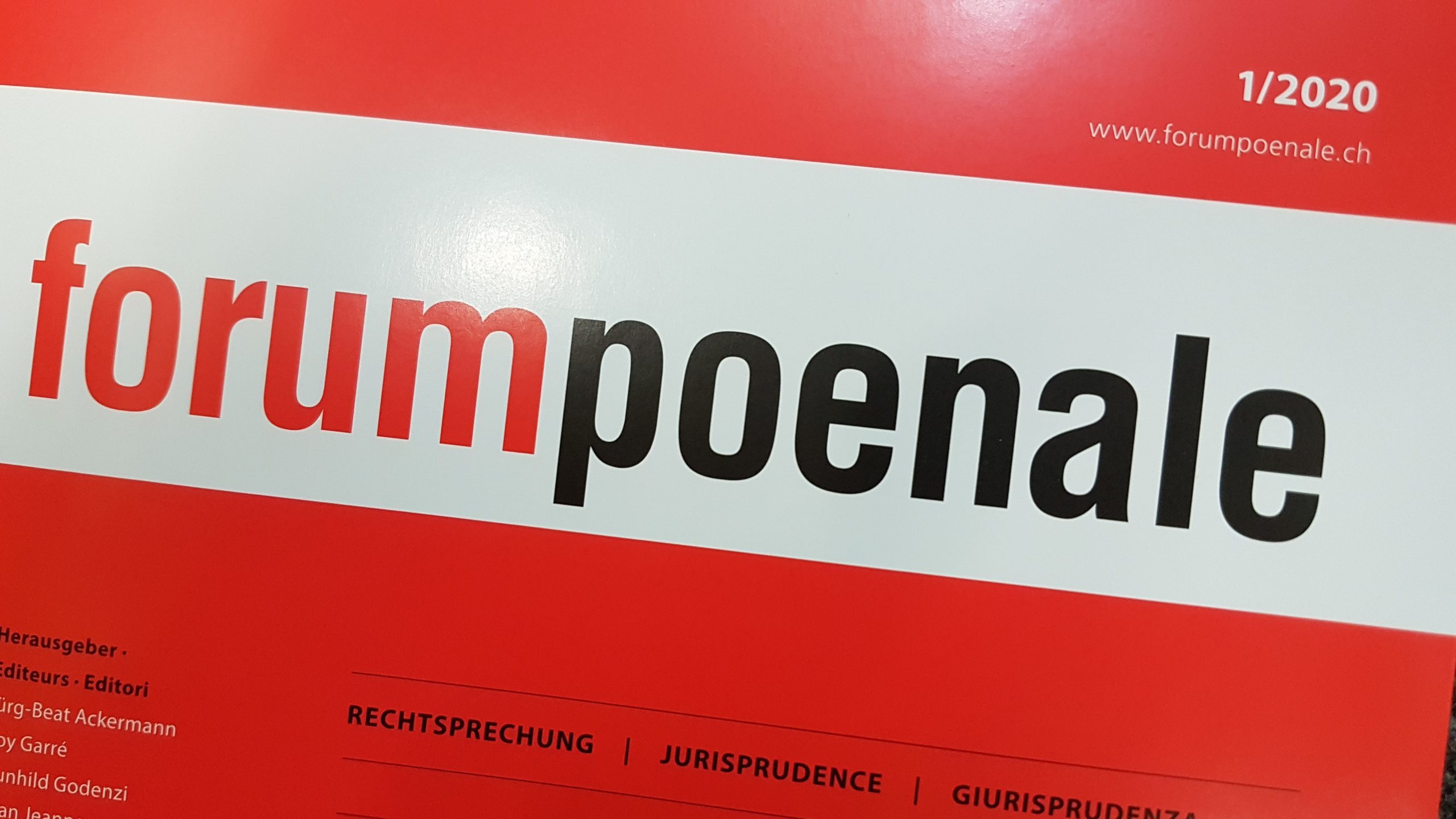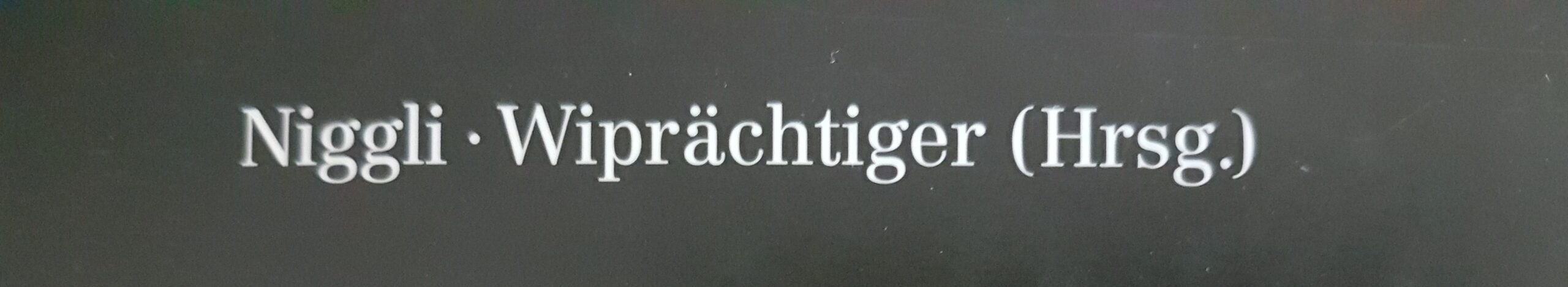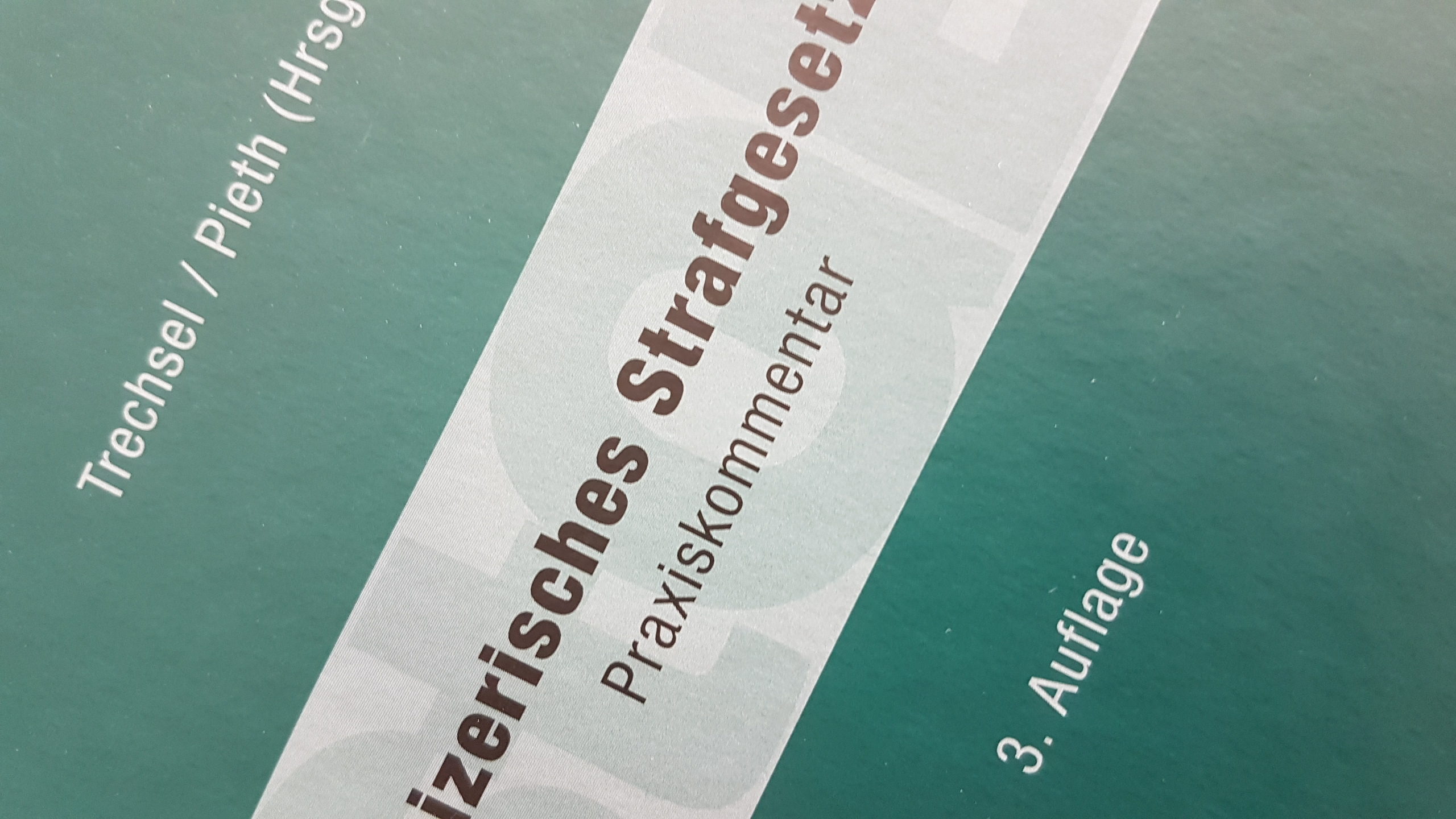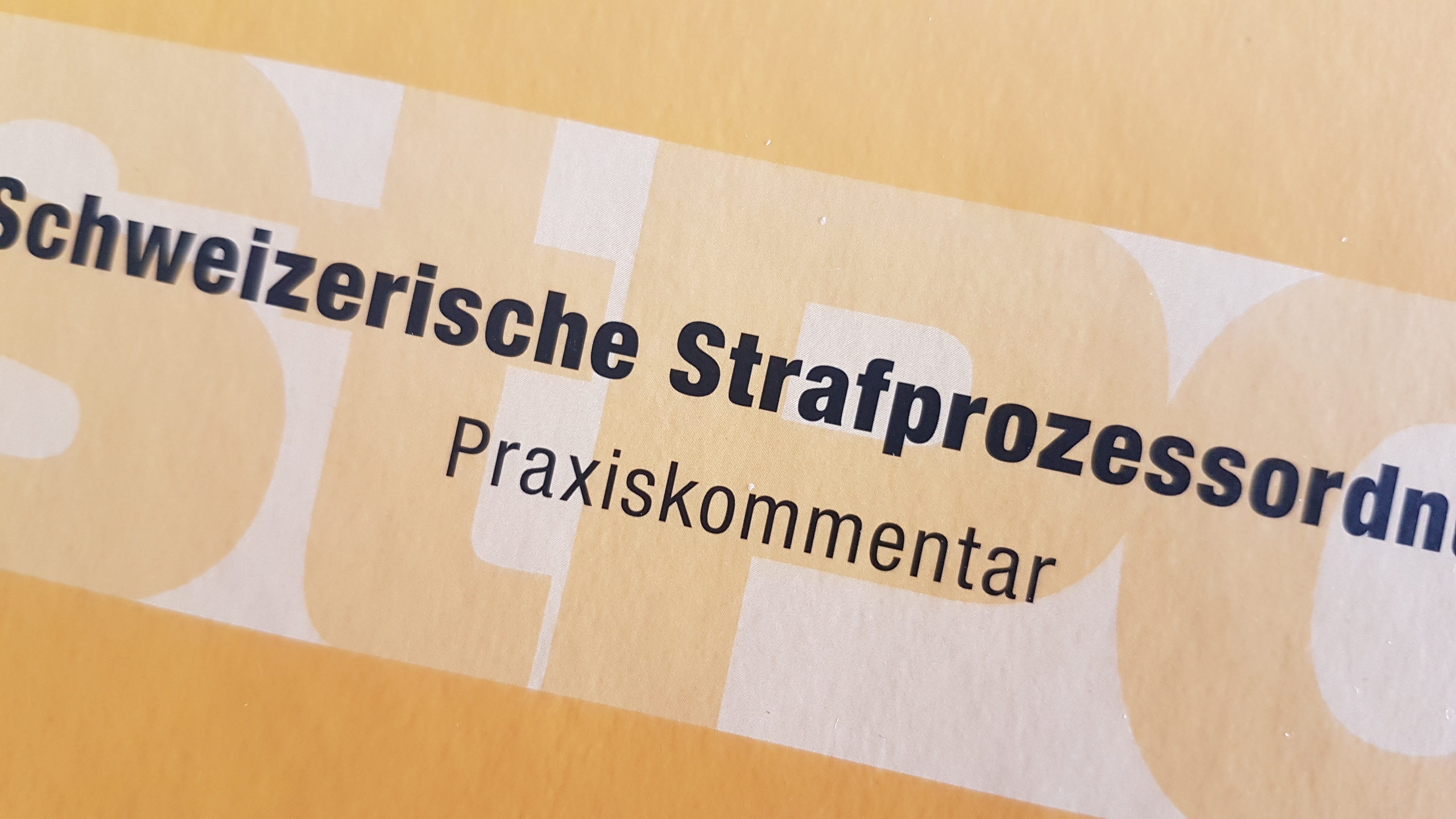Unser Klient erhält einen Strafbefehl, mit dem er für diverse Straftaten zu einer Geldstrafe verurteilt wird. Weil er die Straftaten während der Probezeit für frühere Verurteilungen begangen hat, handelt es sich um eine unbedingt ausgefällte Gesamtstrafe. Nachdem wir an der Schuldfähigkeit Zweifel haben, erheben wir Einsprache gegen den Strafbefehl, lassen uns zum amtlichen Verteidiger ernennen und beantragen die gutachterliche Abklärung der Schuldfähigkeit (Art. 20 StGB).
Nach Vorliegen des Gutachtens stellt uns dieses die Staatsanwaltschaft zur Stellungnahme zu. Das Gutachten verneint wenig überraschend die Schuldfähigkeit komplett. Weil der Klient jedoch unter keinen Umständen in die gutachterlich vorgeschlagene stationäre Maßnahme unbekannter Dauer will, ziehen wir die Einsprache zurück. Das will nun die Staatsanwaltschaft nicht akzeptieren und sie stellt mittels Verfügung die Wirkungslosigkeit der Einsprache fest.
Die dagegen erhobene Beschwerde (vgl. Art. 393 ff. StPO) heißt die Beschwerdekammer des Obergerichts gut. Es schließt sich unserer Auffassung an, wonach die Einsprache solange zurückgezogen werden kann, bis sich die Staatsanwaltschaft gemäß Art. 355 Abs. 3 StPO gegen eine Anklage entschieden hat. Würde sie, was dem Normalfall entspricht, mittels Überweisung Anklage erheben, könnte die Einsprache sogar noch an der Hauptverhandlung vor dem erstinstanzlichen Gericht zurückgezogen werden (vgl. Art. 356 Abs. 3 StPO). Hier war wohl ein Antrag auf ein selbständiges Maßnahmeverfahren gegen Schuldunfähige naheliegend (vgl. Art. 374 f. StPO), doch hatte sich die Staatsanwaltschaft dazu im Zeitpunkt des Einspracherückzugs noch gar nicht entschieden. Die Staatsanwaltschaft machte nichts anderes als ihre ursprünglich fehlerhafte Verfügung (Strafbefehl trotz Schuldunfähigkeit) in Wiedererwägung zu ziehen, was im Strafprozessrecht grundsätzlich nicht zulässig ist.